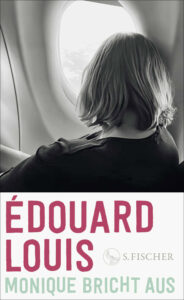 Monique Bellegeule tritt aus der Unsichtbarkeit
Monique Bellegeule tritt aus der Unsichtbarkeit
„Mit dem kleinen, stillen Buch ,Die Freiheit einer Frau‘ tritt eine Frau aus der Unsichtbarkeit.“ (TrokkenPresse 1/2023).
Als ich nun las, dass es in Édouard Louis‘ neuem Buch „Monique bricht aus“ wieder um die Geschichte seiner Mutter gehen würde, war ich neugierig und verwundert.
„Ich habe mich von deinem Vater befreit und dachte, jetzt wird alles besser, jetzt fängt ein neues Leben an, aber es geht wieder los, es geht wieder von vorne los, […]. Ich weiß auch nicht, warum mein Leben so scheiße ist, warum ich immer an Männer gerate, die mich nicht glücklich machen, die wollen, dass ich leide, das hab ich doch nicht verdient, bin ich denn so ein schlechter Mensch?“ Erneut, nun schon zum dritten Mal, muss sich Monique entschlossen und mutig befreien. Befreien vom Alkoholiker, Gewalttäter, ihrer Scham, vom Schweigen.
Die aktuelle Geschichte ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch eine persönliche sowie gesellschaftskritische Reflexion über die Bedingungen von Trennung und Aufbruch, von Freiheit und Befreiung. Unübersehbar das zutiefst starke Bedürfnis des Sohnes, daran mitzuwirken. Louis beschreibt den Kampf seiner Mutter und das, was im Prozess ihrer Emanzipation als Fünfundfünfzigjährige mit ihr geschieht, als einen „Krieg gegen eine ganze Armee von Noch-Nie“. Sie muss lernen, selbstständig zu sein, auf sich zu achten – und vor allem: nicht dorthin zurückzukehren, von wo sie geflüchtet ist.
Édouard gewährt seiner Mutter Unterschlupf in seiner Pariser Wohnung. Er spürt ihre Dankbarkeit, aber nimmt auch die Müdigkeit seiner Mutter wahr.
„Müdigkeit, das war im Leben meiner Mutter immer das deutlichste Anzeichen dafür gewesen, dass ihr Unrecht geschah. Müdigkeit, weil sie zu einem Hausfrauendasein gezwungen war, Müdigkeit, weil sie gedemütigt wurde, Müdigkeit, weil sie weglaufen musste, Müdigkeit, weil sie sich abrackern musste, Müdigkeit, weil sie immer wieder von vorne anfangen musste. Manche werden vom Leben getragen, für andere ist das Leben ein ständiger Kampf. Wer zur zweiten Kategorie gehört, ist müde.“
„Warum helfe ich ihr“, fragt sich Louis immer wieder. Wir bekommen eine Ahnung, eine eindeutige Antwort bleibt er jedoch schuldig. Wahrscheinlich, weil es sie nicht gibt. Und Geld spielt eine Rolle. Geld, das sie nicht hat. Louis muss feststellen, dass seiner Mutter ohne seine finanzielle Unterstützung keine andere Wahl bliebe, als der Sicherung ihrer Existenz wegen zu ihrem gewalttätigen Partner zurückzukehren. Dieses soziale Dilemma beschreibt der Autor auf bittere und sehr eindrucksvolle Weise. Zugespitzt formuliert er: „Ich könnte sagen: Kein Leid in meiner Kindheit = keine Bücher = kein Geld = keine Freiheit.“
Wir begleiten die Protagonistin der Geschichte auf ihrer Reise der Selbstentdeckung und Transformation, bei der sie zur Hauptfigur ihres eigenen Lebens wird. Sie dient zugleich als Hoffnungsschimmer für andere Frauen in ähnlichen Situationen.
Louis bereichert die Erzählung durch seine Biografie, die mit der Mutter verbrachte Kindheit und Jugend. Seine erwachsene Sicht auf diese Zeit ist differenzierter und reifer geworden: Neben Vorwürfen und Bitterkeit schwingt auch Verständnis mit. In seinen Gedanken treffen Wut und Zärtlichkeit aufeinander.
Louis Schreibstil zeichnet sich erneut durch Schnörkellosigkeit aus. Keine Sentimentalität, kein Drama. Auch Heiterkeit in der Bitternis. Er versteht das Milieu, über das er schreibt. In einfachen Fragmenten erzählt er schonungslos und respektvoll, liebevoll und einfühlsam, besorgt und voller Stolz. Die authentische Geschichte ist tröstlich, weil sie ein solch warmherziges Happy End hat. Zugleich sehr bewegend, weil sie die Zusammenhänge von Gewalt, Sprachlosigkeit und Armut aufzeigt.
Eine der berührendsten Passagen der Erzählung für mich: Der Autor berichtet von der gemeinsamen Reise mit der Mutter nach Deutschland, wo „Die Freiheit einer Frau“ auf einer Theaterbühne dargestellt wurde. Seine Mutter sitzt neben ihm im Theater und darf als Heldin des Abends als Letzte zur Verbeugung auf die Bühne treten. Der Sohn voller Stolz.
Übrigens: Meine eingangs erwähnte Verwunderung über ein zweites Buch über die Selbstermächtigung von Monique löste sich damit auf: Es war nach diesem Abend der Wunsch der Mutter. „Ich habe nicht entschieden, es zu schreiben. Es war nicht meine Idee. Noch nie hat mir das Schreiben so große Freude bereitet.“
Monique konnte mit vermeintlich kleinen Schritten und ein wenig Unterstützung aus einer hoffnungslosen Lage ausbrechen. Die klare Botschaft: Freiheit ist oft greifbarer, als man denkt, wenn man den Mut findet, sie zu ergreifen.
Hans-Jürgen Schwebke
ÉDOUARD LOUIS: Monique bricht aus. Übersetzt von Sonja Finck, 160 Seiten, S. Fischer Verlag 2025. Geb. Ausgabe: 22 €, ISBN 978-3-10-397558-1
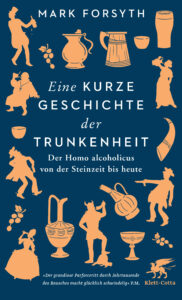 Der Homo alcoholicus von der Steinzeit bis heute
Der Homo alcoholicus von der Steinzeit bis heute
Bereits die Einleitung dieses Buches beeindruckt: Der Autor gesteht, er wisse überhaupt nicht, was Trunkenheit ist. Er kenne jedoch die grundlegenden medizinischen Fakten. Trunkenheit sei so gut wie universell, fast jede Kultur der Welt verfüge über Stoff. „Menschen sind fürs Trinken geschaffen.“
Es folgt eine beeindruckende Geschichte des Alkohols von der Evolution bis fast in die Gegenwart. Das Buch zeichnet sich durch ein sehr großes Faktenwissen aus. Man glaubt dem Autor sofort, wenn er schreibt, ab einem Alter von 14 Jahren empirische Studien zur Trunkenheit betrieben zu haben. Sein Wissen spiegelt sich in einer umfänglichen Bibliografie zu allen Kapiteln wider.
Forsyth zeigt eindrücklich die Parallelen bei einer Trunkenheit zwischen Menschen und der Tierwelt auf. Ratten verhalten sich beim Trinken zivilisiert, besoffene Elefanten randalieren. Darwin zog als erster den richtigen Schluss: Wenn Menschen und Affen genau gleich auf einen Kater reagieren, müssen sie miteinander verwandt sein.
Bier gab es schon sehr früh. Unsere Frühmenschen begriffen schnell, dass Bier einfach ein besseres Nahrungsmittel als Brot ist. Allein die alten Griechen tranken kein Bier, sondern bevorzugten Wein.
Schön zu lesen ist das Kapitel über Australien. Es sollte eigentlich eine trockene englische Kolonie sein. Der Plan ging nicht auf. Das Schiff mit den Sträflingen, die Australien besiedeln sollten, startete 1787 von England mit Alkohol an Bord. Ohne Alkohol, damals vor allem Rum, hätte weder ein Seemann noch ein Marinesoldat angeheuert.
Etwa zur gleichen Zeit produzierte die größte Destillerie in Amerika bereits 11 000 Liter Whisky pro Jahr. Deren Besitzer George Washington war ab 1789 der erste amerikanische Präsident.
Natürlich darf „Mütterchen Russland“ hier nicht fehlen. 1914 erklärte der Zar den Verkauf von Wodka für ungesetzlich, vier Jahre später wurde er ermordet. Russland steht für Wodka. Etwa jeder vierte Tod ist dort alkoholbedingt. Russland wurde von den durch Alkohol erzielten Einnahmen abhängig. Stalin regierte das große Land lange, weil er immer dafür sorgte, dass sein Politbüro trank, trank und nochmals trank.
Die amerikanische Prohibition in den USA, die von 1920 bis 1933 dauerte, gilt heute als der letzte groß angelegte Versuch, Trunkenheit und darauf fußende Gewalt zu verbieten. Sie richtete sich vor allem gegen den Whisky und andere Spirituosen. Der Anfang vom Ende war der große Börsencrash 1929. Die amerikanische Wirtschaft taumelte, Alkohol herzustellen bot hunderttausenden Menschen wieder Arbeit. Prohibition gab es in dieser Zeit auch in Island, Finnland und Norwegen.
Das überaus kenntnisreich geschriebene Buch endet mit einem sehr lesenswerten Epilog. Wo immer und wann immer Menschen gelebt haben, kamen sie zusammen, um sich gemeinsam zu berauschen. Es gibt seit Jahrtausenden das sogenannte Übergangstrinken, den Wechsel von einem Zustand in den anderen mit Alkohol zu begleiten: Trinken bei Taufen, bei Hochzeiten, bei Begräbnissen, nicht zu vergessen bei Geburtstagen und beim Jahreswechsel. Außerdem trinken Menschen, um der Langeweile zu entkommen. Es ist ihnen nicht langweilig, wenn sie betrunken sind. Gleichzeitig arbeiten Menschen gern auch betrunken. Und zwar überall: Von zwei Space-Shuttle-Starts ist bekannt, dass alle Astronauten „bis oben hin abgefüllt waren“.
Norbert Schumacher
MARK FORSYTH, Eine kurze Geschichte der Trunkenheit – Der Homo alcoholicus von der Steinzeit bis heute, Verlag Klett-Cotta, ca. 270 Seiten, 12 Euro, ISBN: 978-3-608-96483-7
Stadt
Der zweite Band „Stadt“ der Trilogie von Thomas Korsgaard, nach dem ersten Band „Hof“ (TrokkenPresse 06/2024) des den dänischen Star-Autors, liegt nun in deutscher Sprache vor.
In „Stadt“ erzählt der Ich-Erzähler Tue weiter über sein tristes Leben auf dem dänischen Land und nun in der Kleinstadt, er ist der älteste Nachkomme einer recht dysfunktionalen Familie, von der er sich aber nicht so recht lösen kann. Tue geht jetzt auf die Oberschule in der Stadt, in die er mit dem Bus fahren muss. Seine Mutter hat eine umfangreiche Entschädigung für einen Unfall erhalten, die Familie ist die gröbsten finanziellen Sorgen los. Der gewalttätige Vater arbeitet sommers als Gärtner und winters als Schlachter in einer Fleischfabrik.
Tue wir nun erwachsen, seine Großmütter sterben, sein Bruder geht ins Internat, seine depressive und spielsüchtige Mutter hat einen Mann aus Fünen im Internet kennengelernt. Eine Mitschülerin interessiert sich für ihn, aber Tue ist homosexuell und küsst zum ersten Mal einen Jungen. Es wird von allen Beteiligten geraucht, gesoffen und gekifft.
Die in 68 Kapitel aufgegliederten Episoden machen es der Leserin oder dem Leser schwer, der Handlung zu folgen. Die Texte stehen solitär, ohne Bezug zum vorhergehenden oder folgenden Kapitel. Eine örtliche und zeitliche Orientierung fällt schwer. Auch gibt Tue kaum Hinweise über seine Gedanken und Gefühlswelt, es werden trocken Begebenheiten aufgezählt.
Dieser Schreibstil spiegelt wohl die mediale Neuzeit wider, die sich in (Des-) Informationsschnipseln in den sogenannten sozialen Netzwerken zusammensetzt und die weiterhin sinkende Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer berücksichtigt.
Der Band endet: Tue steigt aus einem Bus in Valby, einem Stadtteil von Kopenhagen, und will eigentlich nach Frederiksberg, einen anderen Stadtteil.
Gespannt darf man auf den dritten, abschließenden Band sein, der die Leserin, den Leser auf den weiten Weg von „Hof“, über „Stadt“ im Herbst 2025 ins „Paradies“ führt. Vielleicht gibt es am Ende die Auflösung des Rätsels über Tue. Bisher blieb der Leser, die Leserin recht ratlos zurück.
Torsten Hübler
THOMAS KORSGAARD (Übers. V. J. Carl & K. Schöps, Stadt, 288 Seiten, geb., Kanon Verlag, ISBN 978-3-98568-141-9, 24,00 Euro
Bas Kast: Warum ich keinen Alkohol mehr trinke
Dankbar! Denn wieder einmal, nach dem „Ernährungskompass“ und dem „Kompass für die Seele“, hat sich Bestsellerautor und Wissenschaftsjournalist Bas Kast die mühevolle Arbeit für uns gemacht, sämtliche verfügbare Studien der Welt zu einem Thema zu suchen, auszuwerten und zu vergleichen.
Diesmal geht es hauptsächlich darum, welche Trinkmenge an Alkohol nun tatsächlich risikoarm sei und was das bedeutet. Denn die neueste Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lautet: Nur ein bis zwei Gläschen Wein (als Beispiel) pro WOCHE gelten nunmehr als risikoarm für die Gesundheit. Es ist aber eben immer noch ein Risiko dabei … und worin besteht das?
Bas Kast erklärt sehr anschaulich, flüssig und einfach nachzuvollziehen, was vom ersten Schluck im Munde an passiert, wie Enzyme den Alkohol abbauen in die giftige Vorstufe Acetaldehyd und wie unsere Zellen und ihr Erbgut darauf reagieren (können), bewiesener Weise bis zum Krebs sogar. Er erläutert auch, was im Kopf passiert, von GABA über Glutamat zu Dopamin, und endlich habe ich diese Zusammenhänge jetzt mal verstehen können. Dopamin zum Beispiel wird bei einem „prediction error“, einem Vorhersagefehler des Gehirns, verstärkt ausgeschüttet, schön an Beispielen erklärt.
Er geht auch auf den bisherigen Glauben ein, ein Glas Wein am Abend sei Herz-Kreislauf-stärkend, also gesund. Genau nimmt er auseinander, welche Forschungen es dazu gab (keine eindeutigen) und wieso sich die Vermutung weiter unter Wissenschaftlern hält. Dennoch aber bleibt: Keine Konsummenge ist risikofrei, ganz besonders in Bezug auf alkoholbedingt entstehenden Krebs.
Bas Kast wendet sich nicht an Alkoholmissbräuchler und Suchtkranke, sondern vor allem an „normal“ trinkende Menschen, wie er gefühlt selbst einer war, aus einer Weinbauernfamilie stammend, in der zwar immer sehr maßvoll, aber dennoch nicht selten und dann fröhlich und wie selbstverständlich ein Glas Wein getrunken wurde. Er hörte damit auf, als er eben jene aktuellen Studien und Empfehlungen zur Kenntnis nahm, was gleichzeitig der Auslöser für das Buch war: Nämlich alles genauer unter die Lupe zu nehmen. Und anderen eine Entscheidungshilfe zu geben. Sein Fazit: „Natürlich darf jeder von uns trinken. Natürlich soll jeder genießen können. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass jeder wissen sollte, was man da zelebriert. Unsere Entscheidung sollte zumindest eine bewusste sein, basierend auf dem, was wir heute wissen.“
Und mein Fazit (bevor diese Rezension länger wird als sein Büchlein ;-), es beträgt diesmal nur knapp über 100 Seiten): Sehr empfehlenswert, weil eben diese etwas über 100 Seiten voll mit tiefergehendem neuen Wissen sind, dankenswerter Weise für uns schon hingebungsvoll recherchiert, aufgearbeitet und anschaulichst vorgestellt. Und dieses Wissen ist auch für uns trockene alkoholkranke Menschen wichtig, finde ich.
Anja Wilhelm
BAS KAST, Warum ich keinen Alkohol mehr trinke, penguin Verlag, Hardcover, 112 Seiten, ISBN: 978-3-570-10581-8, 22 Euro
Dry January extended
Trinkpause
Der in München lebende bekannte Journalist Felix Hutt dokumentiert sein Vorhaben, ein Jahr lang relativ wenig Alkohol zu trinken.
Mit Mitte Vierzig beschließt Hutt, nach einigen alkoholischen Ausfällen, die sein gesellschaftliches und sein persönliches Umfeld betrafen, ein Jahr keinen Alkohol zu trinken. Er legt diese Entscheidung als journalistisches Buchprojekt an, damit er einen nachvollziehbaren Grund für sein alkoholisches Umfeld vorgeben kann und sich nicht dem Abwägen „Normaltrinker“/Alkoholiker im Freundeskreis aussetzen muss. „Nichtmittrinken verlangt triftige Gründe“, erkennt er selber.
Begonnen wird seine Trinkpause mit einem „Abschiedscocktail“ in Münchens renommiertester Bar, in der er gerne verkehrt. Im weiteren Verlauf wird sein Verhältnis zu seinem dem Alkohol zugewandten, verstorbenen Vater thematisiert. Tagebuchartig notiert er sein (Nicht-)Trinkverhalten, seine Gefühle und Gedanken, seinen körperlichen Zustand. Er spricht mit renommierten Suchtforschern. Trotz der Besserung seiner körperlichen Fitness und seiner Psyche, die durch die Trennung seiner Frau von ihm und die familiären Kalamitäten zusätzlich belastet wird, zieht er mehrmals einen seiner „Joker“, die er sich zugebilligt hat und besäuft sich gnadenlos bis an den Rande der Bewusstlosigkeit. „Gegen den Strom zu schwimmen kostet mehr Energie, als sich treiben zu lassen …“ sinniert er auf dem Oktoberfest, vor einer alkoholfreien Maß sitzend, Monate nach Beginn seines Projektes. Er scheitert am „Endgegner“ Oktoberfest und betrinkt sich über die Maßen. Dieser Exzess bestärkt ihn aber in seinem Wunsch nach einem abstinenten Leben. Im vorletzten Kapitel wird sein Besuch bei den Anonymen Alkoholikern aufgezeichnet.
Ob Felix Hutt alkoholkrank ist, wissen nur er selbst und sein Arzt, die Schilderung dieses ereignisreichen Jahres ist sehr ehrlich und trotzdem gut und spannend geschrieben. Dabei gibt der Autor auch viele Informationen über Alkohol und Alkoholismus preis. Ein Quellenverzeichnis von Simon Borowiaks „Alk“ über den „Alkoholatlas 2022“ bis zu Daniel Schreibers „Nüchtern“ runden dies Auseinandersetzung mit dem eigenen Umgang mit Alkohol ab.
Ein sehr empfehlenswerter und flüssig lesbarer Titel, der sich gut zur Weitergabe an vermeintlich normal trinkende Personen eignet, da hier ein konsumierender, erfolgreicher, mitten im Leben stehender Mensch sich die körperlichen, mentalen und gesellschaftlichen Gefahren des Alkohols „freiwillig“ bewusst macht, ohne mit dem moralischen Zeigefinger zu drohen.
Torsten Hübler
Felix Hutt, Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol, 256 Seiten, Klappenbroschur, Goldmann Taschenbuch, ISBN 978-3-442-18014-1, 18,- Euro
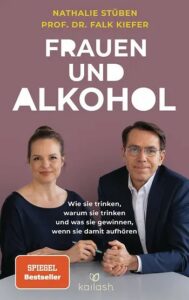 Frauen und Alkohol
Frauen und Alkohol
„Ab wann hat man denn ein Problem mit Alkohol?“
Vor allem an alle Frauen und Mädchen, die sich diese Eingangs-Frage stellen, wendet sich dieses Buch. Egal, ob SIE wenig trinkt, mittel, viel oder auch bereits abhängig ist. Journalistin Nathalie Stüben, die mit ihrem Online-Programm OAMN (Ohne Alkohol mit Nathalie) bereits vielen hunderten Frauen beim Abstinentwerden half und Falk Kiefer, u. a. Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim, sind die Autoren.
Planen Sie lieber etwas mehr Lesezeit ein, liebe LeserInnen. Die 284 Seiten sind unmöglich leicht überfliegbar. Sollen sie auch nicht sein, wir wollen ja neue Erkenntnisse, Wissen, Aha-Effekte zum Thema. Und das bieten sie unbedingt! Nicht umsonst ist das Quellenverzeichnis neun Seiten lang: Die Autoren haben aktuellste Studien bis ins Kleinste recherchiert und schreiberisch aufbereitet, so dass alles nachvollziehbar wird, manchmal bis ins Detail. Hochachtung davor, wirklich!
Worum geht es nun? Um die Beantwortung der Eingangsfrage siehe oben. Und speziell für Frauen ist das Buch gedacht, weil sie eben anders trinken, aus anderen Gründen, schneller an Folgeschäden erkranken, schneller süchtig werden. Und das jeweils noch in verschiedenen Generationen sehr unterschiedlich. Das bebildern uns die „Fallbeispiele“, konstruierte Trink-Geschichten von Carmen (50, in leitender Position, Generation X), Sabine (63, Hausfrau und Mutter, Babyboomerin), Helga (81, Rentnerin, Stille Generation), Jamila (38, Migrantentochter, Mutter, Generation Y), Elena (Influencerin, 23, Generation Z).
Anhand ihrer Beispiele – die erzählen, wie und warum sie Alkohol trinken, später erkennen, was sie damit eigentlich tun und am Ende des Buches mit Hilfe unterschiedlichster Art abstinent werden – wird jeweils aktuelles Wissen eingeflochten. Zum Beispiel, was Alkohol im weiblichen Körper und der Psyche anrichtet. Jeder Tropfen übrigens! Wie Frau sich verändert, sich die Persönlichkeit „entkernt“. Bildlich beschrieben, was vor sich geht. Auch in den Wechseljahren. Im Schlaf. Mit dem Wesen. Beeindruckend war für mich nochmal, dass Alkohol den Krebs einlädt, das ist zwar inzwischen bekannt. Aber dass die Moleküle so klein sind und in jede Zelle wandern können und dort drinnen die Regeneration, die Reparatur stören bis hin zum Erbgut – das war mir nicht so direkt vor Augen. Ein Zellgift, ja! Auch in den kleinsten Mengen!
Es geht um Stigmatisierung. Um Alkoholpolitik und Werbeziele. Um GABA und Dopamin. Um Selbstbetrug und Selbstliebe. Um Emotionen und ihre Regulierung. Um Hilfsangebote aller Art: Therapieformen und die neue positive Psychologie. Um Trauma. Um Cis- und Trans-Frauen. Und vieles mehr … ins Detail zu gehen ist hier unmöglich, es sind derer einfach zu viele.
Geschrieben finde ich es auch wunderbar. Frisch und gut lesbar und spannend.
Wie zufrieden und befreiend das neue Leben ohne Alkohol sein kann … und wie viel Veränderung im Selbst nötig ist (Alkoholkonsum weist besonders bei Frauen auf seelische Missstände und unerfüllte Bedürfnisse hin) und möglich werden kann – dies kommt nicht nur in den Fallbeispielen rüber, sondern schimmert durch viele Zeilen und Seiten. Und das ist auch das Schöne: Es ist ein Aufklärungsbuch ohne erhobenen Zeigefinger. Die eigene Überzeugung kann mitwachsen, alleine schon durch die Fülle an neuen Fakten.
Die Eingangsfrage klärt sich für jede Leserin dann wohl auch höchstpersönlich selbst.
Mein Fazit: Schenken Sie das Buch sich selbst. Oder ihrer trinkenden Freundin. Oder Ihren Töchtern …
Anja Wilhelm
NATHALIE STÜBEN/FALK KIEFER, Frauen und Alkohol: Wie sie trinken, warum sie trinken und was sie gewinnen, wenn sie damit aufhören, Kailash Verlag, geb., 303 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-424-63262-0
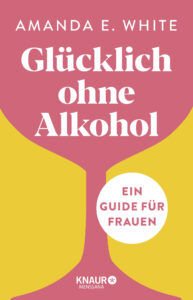
Glücklich ohne Alkohol
Gleich mal vorweg: Es ist nicht das typische „Trinkerbuch“: So habe ich gelitten und so bin ich trocken geworden. Es will auch kein Ratgeber für Suchtkranke sein und niemanden davon überzeugen, dem Alkohol adé zu sagen.
Was ist es dann?
Ein sehr einfühlsames, fast liebevolles Buch für Frauen, die bemerken, dass sie entweder zu häufig oder auch viel zu viel trinken. Die das Gefühl haben, der Konsum oder Missbrauch tue ihnen nicht mehr gut, ohne ihn jedoch abstellen zu können.
Die Autorin war selbst abhängig von Alkohol und arbeitet inzwischen als Therapeutin. Anhand von drei typischen Klientinnen (Tara ist jung, weiß und hat Entzüge hinter sich, Brianna ist eine berufstätige Schwarze Frau mit zwei Kindern und Andrea, peruanische Einwandern, studiert Medizin) und geschilderten Beratungssituationen in jedem Kapitel erfahren wir Schritt für Schritt mit ihnen mit, was und wie und vor allem, warum sie trinken oder tranken.
Begleitet werden diese Beratungsauszüge von vielen Erläuterungen, von psychologischen Erkenntnissen und von Hintergrundwissen. Zum Beispiel: Unser Gehirn ist seit der Steinzeit, unverändert, aufs Überleben ausgerichtet, ein „Lass-Dich-nicht-umbringen-Gerät“ und versetzt den Körper in die Lage, blitzschnell zu fliehen oder zu kämpfen. Wobei dies ja einst nur eine Sache (Säbelzahntiger) von Stunden war und dann wieder der Erholungsmodus einsetzte. Heutzutage geht es zwar selten um Leben und Tod, aber wir sind auch bei kleineren Angelegenheiten bereits im Stressmodus Kampf oder Flucht. Das beginnt vielleicht mit einem Stau im Berufsverkehr, mit Termindruck, geht weiter über Ärger im Job hin zu Sorgen ums kranke Kind bis zu aufregenden Videos oder Chats rund um die Uhr und und und. Der Körper steht unter Dauer-Stress – ohne die notwendigen Erholphasen zu erhalten. Oft werden dann Drogen wie Alkohol benutzt, um scheinbar etwas „runterzukommen“ oder schlafen zu können.
Brianna ist so eine Klientin, die sich überfordert fühlt mit Job und Kindern und der Welt. Vor allem aber fühlt sie sich schuldig, weil sie ihrer Rolle nicht gerecht zu werden glaubt. Deshalb trinkt sie. Später erfahren wir noch von ihrem Trauma, das sie betäubt.
Oder Andrea. Super ehrgeizig, alles will sie perfekt erledigen und die hohen Erwartungen ihrer Eltern erfüllen. Sie trinkt – auch, weil sie schüchtern ist – alle Besäufnisse ihrer Kommilitonen mit, weil sie nicht weiß, wie sie sonst entspannen könnte. Oder gar, wie sie allen erklären soll, dass sie nicht mehr trinkt.
Die Autorin führt die Frauen dahin, selbst zu erkennen, warum sie trinken, wo ihre psychologischen Ursachen liegen. Und im zweiten Kapitel gibt sie Hinweise, wie frau gegen diese Ursachen angehen könnte. Wie man sich neu „beeltert“ (Reparenting), Selbstfürsorge übt, seine Emotionen zu regulieren lernt, Grenzen auslotet und gegenüber anderen zu setzen lernt.
Da es der Autorin nie darum geht, vom Nüchternleben zu überzeugen, beschäftigt sie sich auch mit dem kontrollierten Trinken. Ohne zu verurteilen – das tut sie wohltuend im ganzen Buch nicht – gibt sie lediglich Informationen kund. Ein interessantes Argument hier z.B.: Achtung, Entscheidungsmüdigkeit, also emotionale oder geistige Erschöpfung, wenn man ständig Optionen abwägen muss. „Je mehr Entscheidungen man an einem Tag trifft, und seien es auch nur kleine, alltägliche, desto stärker steigt die Erschöpfung und desto wahrscheinlicher ist es, schlechte Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist es viel einfacher, nicht zu trinken. Man trifft e i n e Entscheidung …“
Das dritte Kapitel steht unter dem Motto: Wie Sie sich ein Leben aufbauen, vor dem Sie nicht davonlaufen müssen. Sehr Mut machend und hoffnungsvoll. Auch die drei Klientinnen haben inzwischen vieles verändert in ihrem Leben, sind schon lange Zeit nüchtern – und erfüllter und glücklicher.
Dank der Übungsbögen mit persönlichen Fragen zu den jeweiligen Themen kann sich jede Leserin direkt mitbeteiligen, sich selbst mit-erkunden, mit-erkennen und sich mit-entscheiden.
Ich finde, es ist ein wunderbares Selbsthilfebuch für Frauen. Und selbst als schon 13 Jahre Trockene habe ich für mich viele neue Erkenntnisse gewinnen können …
Anja Wilhelm
AMANDA E. WHITE, Glücklich ohne Alkohol, Knaur Verlag, MENSSANA, TB, 304 Seiten, ISBN: 978-3-426-65995-3, 20 Euro
Strunk versucht Weltliteratur
Wenn der Berg zur Fläche wird
Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk, Jahrgang 1962, veröffentlicht zum 100. Jahrestages des Erscheinens von Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ seinen „Zauberberg 2“.
Jonas Heidebrink, der erfolgreiche Start-Up-Unternehmer, der zum richtigen Zeitpunkt sein Unternehmen verkauft hat und künftig ein materiell arbeits- und sorgenfreies Leben führen kann, ist die zentrale Person in diesem Roman. Hier versucht sich Strunk an Weltliteratur. Heidebrink begibt sich in ein Sanatorium, eine psycho-somatischen Fachklinik, in einer Schlossanlage zwischen Pasewalk und Ueckermünde. Im brandenburgischen „Polenrandgebiet“. Die Beschwerden sind weniger körperlicher Art als psychischer. Er hat Angstzustände und eine große Leere hat sich in seinem Inneren ausgebreitet und er will dieses Manko mithilfe eines Klinikaufenthaltes beheben. Statt des anvisierten einen Monats verlängert der „Selbstzahler“ seinen Klinikaufenthalt bis ultimo. Bis die Einrichtung schließt, schließen muss.
Mit dem gewohnten Strunk-Humor wird der Tages- und Wochenrhythmus geschildert. Die Therapien und Therapeuten werden beschrieben sowie das ganze Sammelsurium der Genesenden und Helfenden. Wer schon mal in einer Rehabilitationseinrichtung einige Zeit verbracht hat, wird vieles, überspitzt, wiedererkennen. Ein Klinikalltag wird treffend dargestellt und die „Käseglocke“, die über Patientinnen und Patienten eines solchen Sanatoriums liegt, gut erlebbar gemacht.
Sprachlich-humoristisch bleibt sich Strunk treu, ein wesentlicher Teil des Gedachten und des Gesagten besteht aus Merksätzen, Sentenzen und kalenderspruchartigen Weisheiten, die für den Kontext passend gemacht werden. Wie schon in seinen vorherigen Werken.
Der Roman ist in vier Kapitel unterteilt, und am Ende gibt es sogar, für einen Roman eher ungewöhnlich, ein Quellenverzeichnis.
Lesenswerte leichte Unterhaltung mit Tiefgang, wahrscheinlich keine Weltliteratur.
Torsten Hübler
HEINZ STRUNK, Zauberberg2, 288 S., Hardcover, Rowohlt, ISBN 978-3-498-00711-9, 25,00 Euro
„Alkohol“ aus Bulgarien
Wenn der Facharzt säuft
Dem Rezensenten kam kurz vor Weihnachten der Titel „Alkohol“ des bulgarischen Autors und Psychiaters Kalin Terzijski zufällig in die Hände.
Terzijski, geboren 1970, schildert, wohl recht autobiographisch grundiert, das Leben eines Psychiaters, der das Leben und Wirken als Nervenarzt in einem staatlichen Irrenhaus mit dem Leben und Wirken eines Schriftsellers und Trinkers tauscht. Neben der Schilderung aktueller Abstürze und hoffnungsvoller Projekte gibt es immer wieder Rückblenden in seine Kindheit und Jugend im sozialistischen Land, seine Wehrdienstzeit bei den Grenztruppen, die wilden Jahre während der Wende zum Kapitalismus, in seine Zeit als Pfleger auf einer Krebsstation und seine Zeit als Psychiater in der Heilanstalt. Daneben gibt es regelmäßig Schilderungen von Telefonaten mit einer gewissen, dubiosen Marta, die aus einem Bergdorf heraus eine nicht näher definierte Religion missioniert.
Der Ich-Erzähler schildert in kurzen Episoden, die sich chronologisch nicht auf den ersten Blick einordnen lassen. Eine durchgehende Handlung findet nicht statt. Mittels der erzählerischen Puzzlestücken lässt sich aber einiges, nicht nur über den alkoholischen Niedergang des Protagonisten, erfahren, man bekommt Einblicke in das Leben des osteuropäischen Landes sowie in die Geschichte des Balkanstaates.
Mein erster Eindruck war, dass sich ein Balkan-Bukowski versuchen will, der Leserin, dem Leser das rauschgetriebene Leben eines Sprachschöpfers nahezubringen, die bruchstückhaften und teils unzusammenhängenden Splitter ähneln der Schreibweise des amerikanischen Autors. Man muss das Werk ganz durchlesen, um ein Gesamtwerk zu erkennen. Den Unterschied macht auch, dass der Autor seinen alkoholischen Niedergang nicht nur aus künstlerischer Perspektive betrachtet, sondern auch als Arzt, der alle Wirkungen des Alkohols auf wissenschaftlicher Grundlage kennt und bewerten kann.
Ein sehr interessantes, authentisches und manchmal auch packendes Buch, das sich nicht so einfach „wegliest“ wie geschmeidigere Titel zu diesem Thema, aber einen höheren Erkenntnisgewinn verspricht.
Nebenbei, „Alkohol“ war 2010 das meistverkaufte belletristische Werk in Bulgarien. 2015 erschien es in deutscher Sprache. Die Übersetzung ins charmante österreichische Deutsch besorgte Viktoria Dimitrova Popova. Die deutschsprachige Ausgabe ist immer noch lieferbar, wie eine Nachfrage beim Schweizer Verlag ergab. Es gibt also keinen Grund, dieses Buch nicht zu lesen.
Torsten Hübler
Kalin Terzijski, Dejana Drogoeva, Alkohol, 432 S., Softcover, INK Press, Zürich, ISBN 978-3-906811-00-0, 22,95 Euro
Film:
Nicht ohne meine Tiere
Der Gesundheitswissenschaftler und Suchtmediziner Michael Christian Schulz veröffentlichte unter dem Titel „Die Bedeutung von Kumpantieren für Opioidabhängige in Substitutionstherapie“ eine Studie über dieses spezielle Verhältnis von Mensch und Tier. Dabei befragte er u.a. ehemalige Heroinabhängige, die sich in Substitutionstherapie („Methadonprogramm“) befanden. Diese Interviews berührten ihn so stark, dass er es nicht bei einer „trockenen“ wissenschaftlichen Veröffentlichung belassen wollte, sondern auch der breiten Öffentlichkeit die positiven Wirkungen der Tiere für Menschen in schwierigen Lebenslagen nahebringen wollte. Gemeinsam mit dem unabhängigen Regisseur Volker Meyer-Dabisch drehte er den empathischen, inhaltlich sehr interessanten, oft berührenden, leisen und mit wenigen stilistischen Mitteln auskommenden Dokumentarfilm „Nicht ohne meine Tiere – Ein Film über tierische Suchthelfer“. Dabei gelang es dem Filmteam, eine vertraute, vorurteilsfreie Atmosphäre zu schaffen, in der die jeweils oft sehr bewegenden Biografien ihren Raum finden konnten.
Für viele Suchterkrankte sind Tiere – egal ob Meerschwein, Wellensittich, Katze, Hund, Ratte oder Kaninchen – nicht nur beste Freunde, sondern auch eine enorm wichtige psychische Stütze im Leben. Sie geben Halt, sind tröstende Begleiter, „ersetzen“ fehlende soziale Kontakte, erfordern Tagestruktur. Sie sind allzu oft Lebensretter und Überlebenshilfe. So auch für die mit großer Offenheit erzählenden vier Überlebenden, Drogengebrauchenden: Christina, Claudia, Thomas und Viola mit ihren im Zentrum des Films stehenden Haustieren: Ayoka, Leontin, Karlchen und Dorothy. Für sie verließ der Regisseur seine humanoide Perspektive, legte sich auf die Erde und filmte auf Augenhöhe der Tiere.
Christina ist mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen und nach West-Berlin der 70er Jahre in die Szene-Disco „Sound“ und die Drogenszene abgetaucht. Um ihren Konsum zu finanzieren, verkaufte sie Heroin und später Obdachlosenzeitungen. Zwei große Pitbulls gaben ihr Selbstvertrauen und Schutz vor Übergriffen.
Viola kann sich als Tochter eines Carabiniere keine Drogenexperimente erlauben. Sie war wegen der Technoszene nach Berlin gekommen. Heroin hatte für sie eine starke romantische Anziehung und half zudem gegen ihre Panikattacken. Aber bald konnte sie den Konsum nicht mehr kontrollieren, vielmehr kontrollierte die Sucht nun ihr Leben. Sie brauchte Jahre, um das wieder in den Griff zu bekommen. Ihre Katze half ihr, dem Suchtdruck zu widerstehen und in einem Moment größter Verzweiflung doch nicht Suizid zu begehen. Ihr Gesicht will Viola nicht zeigen, ebenso wenig wie Claudia.
Auch Claudia, Heimkind, Überlebende häuslicher Gewalt, Teil der Berliner Hausbesetzerszene, traut sich nicht, ihr Gesicht zu zeigen. Die Angst vor Stigmatisierung und den möglichen Folgen sitzt tief. Sie erzählt aus dem Schutz der Anonymität über ihr Leben, ihre Suchtkarriere und vor allem ihr Verhältnis zu ihrem Tier – einer Ratte, die allerdings trächtig war und so wurden aus einer bald 57. Keine leichte Aufgabe.
Thomas kommt in Berlin mit 17 in Kontakt mit Heroin, zunächst nur als Wochenenddroge. Erst in Westdeutschland, als Mitglied der Punk Band „Flash Gilden“, deren Musik den Soundtrack für den Film gibt, gerät er in die Sucht. Nach einem Gefängnisaufenthalt wird Thomas rückfällig, sieht keine Perspektive mehr. Suizidversuch. Substitutionsprogramm. Karlchen, sein Kater, begleitet ihn nun schon seit 20 Jahren, gibt seinen Tagen Rhythmus und ist ihm immer ein treuer Gefährte.
Behutsam ergänzen Expert*innen die persönlichen Lebensberichte um den Stand der Forschung und erläutern den besonderen Einfluss von Tieren auf die psychische Gesundheit und Resilienz der Betroffenen.
Es wird überzeugend deutlich, wie wichtig Tiere für Menschen in prekären Lebenslagen sein können. Die Tierhaltenden sollten dafür mehr Anerkennung und Unterstützung erhalten. Man lernt die Drogengebrauchenden – Helden ihres Lebens – mit ihrem Leidensdruck, ihrem Überlebenswillen, von einer völlig anderen Seite kennen, die auch ihre positiven Ressourcen zeigt. Das kann zu einer Entstigmatisierung von Sucht und Drogen beitragen. Denn die authentischen Lebens- und Leidensgeschichten der menschlichen Protagonisten des Films verdeutlichen einmal mehr überzeugend: Drogen-Gebrauch kommt auch aus dem Bedürfnis, trotz schwerer und schwerster Traumen oder psychischen Belastungen ein ganz normales Leben zu führen. Sie werden genommen, um einen Alltag zu leben, einkaufen gehen oder einfach nur mit Menschen reden zu können – so die des Regisseurs Volker Meyer-Dabisch „faszinierende Erkenntnis.“
Hans-Jürgen Schwebke
Nicht ohne meine Tiere, D 2024, Regie Volker Meyer-Dabisch, Buch Michael Christian Schulz. 75 min. Seit 28. November 2024 nur in einzelnen Kinos. Filmverleih: Karl Handke Filmpr.
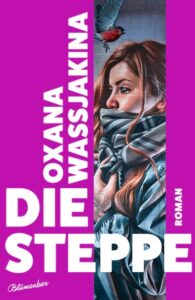 Die Steppe
Die Steppe
Endlose Gräserlandschaft. Kein Baum. Er würde hier verdorren an Wassermangel. Der Blick endet weit weg, irgendwo im Nirgendwo. Hie und da verfallende Dörfchen, weit entfernt voneinander, am Rande der holprigen Straße, auf der ein alter geliehener LKW, beladen mit Eisenrohren, unterwegs ist.
Die Autorin erzählt von dieser Reise aus Astrachan im Süden Russlands nach Moskau. Tausende Kilometer ist sie mit ihrem Vater, dem Fernfahrer mit Leib und Seele, unterwegs. Sie hat ihn bis dahin zehn Jahre nicht gesehen. Auch in ihrer Kindheit recht selten. Sie will ihn auf dieser Fahrt kennenlernen. Ihn verstehen lernen …
Mit diesem roten Faden sind dann ganz viele kleine und große andere Fäden verwoben: Erinnerungen aus der Kindheit, Besuche ihres Vaters bei ihr in Moskau, der spätere Tod ihres Vaters, seine Beerdigung in der Steppe, ihr eigenes Leben als Literaturstudentin und lesbische junge Frau.
Für mich als Leserin waren das recht verwirrende Sprünge: Ähm, wo sind wir jetzt gerade? Mitunter hüpft die Autorin auch mitten im Kapitel von Ort und Zeit zu Ort und Zeit. Immer begleitet auch von wundervollen bildhaften Beschreibungen der Landschaften, ob aus der Steppe, dem Wolgadelta, der Taiga in Sibirien, wo sie aufwuchs – und von philosophischen Betrachtungen über das Leben und seinen Sinn an sich.
Am Ende fasst sie für sich zusammen: „In ihm hat sich die Geschichte der meisten russischen Männer seiner Generation materialisiert.“ Das mag man kaum glauben, denn das Leben des Vaters war für heutige westeuropäische Begriffe sehr dramatisch: Taxifahrer, Fernfahrer, alles für wenig Lohn. Ganove und Dieb (seine Frau trug edle Pelze und Goldschmuck), Gefängniszelle. Das Pflaster wurde dann zu heiß. Er zog weg aus der ungeliebten sibirischen Stadt, verließ seine Familie. Wie sich später herausstellte, misshandelte er damals sogar seine Frau. Er nahm Drogen, Heroin, und war oft betrunken. Wodka spielte immer eine Rolle. Er infizierte sich mit Aids, verweigerte Behandlungen, ließ zwar von den Drogen ab, trank aber weiter und verfiel körperlich, immer von der Hand in den Mund lebend, immer noch fernfahrend. Bis ihn eine Hirnhautentzündung tötet.
„Er war siebenundvierzig, sah aber aus wie ein Greis. Die Steppe hatte mit ihrem Wind und der Sonne an ihm genagt und ihn altern lassen, Aids hatte Teile seines Gesichts und mehrere Finger seiner rechten Hand gelähmt, die Meningitis hatte sein Gehirn zerstört.“ So sachlich beschreibt es die Tochter, die Autorin. So beschreibt sie vieles. Sie beschreibt einfach und manchmal bildhaft, was sie sieht. Und was sie dabei denkt oder fühlt. Ihr Stil. Und, vielleicht merkt sie es gar nicht, sie scheint ihrem wortkargen Vater damit die Worte zu geben, die er selbst nicht reden kann – denn auf ihrer gemeinsamen Reise, nebeneinander im LKW-Führerhaus, an kleinen Lagerfeuern in einsamer, stockdunkler Stille an Seen oder mitten im Meer der Grassteppe – hatte er nicht viel zu erzählen. Redseliger wurde er immer erst, wenn er Alkohol trank.
Das Buch wirkt auf mich irgendwie … wie ein handgewebter Teppich an der Wand einer Jurte, viele kleine Fäden neben einem großen roten ergeben ein Muster, des Vaters Leben. Und ihres bis dahin. Aber die Fädchen sind mitnichten farbenfroh und heiter-bunt. Eher grau und braun. Düster und schwermütig. Diese Art von schwermütig, wie man es von der russischen Seele manchmal erzählen hört. Oder bei Dostojewski oder Aitmatow herauslesen kann.
Ich fand es sehr spannend, als Leserin mit dem Truck tausende Kilometer quer durch Russland „mitgenommen“ worden zu sein, hinein in das Leben der Menschen dort. Aber es ist schon auch ein recht traurig machender Roman. Vielleicht eher etwas für die hellere, heitere Jahreszeit. Ein Sommer-Buch?
Anja Wilhelm
OXANA WASSJAKINA, Die Steppe, Verlag Blumenbar, Hardcover, 267 S., ISBN 978-3-351-05116-7, 24 Euro
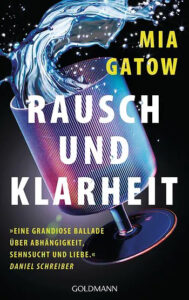 Rausch und Klarheit
Rausch und Klarheit
Wow, was für ein Buch!
Und es hängt noch viele Tage in meinem Kopf herum …
Ob es nun die Schreibe ist, oft in sprachlos machenden eindrücklichen Bildern, oder die Geschichte an sich oder das Gefühl, irgendwie auf einer bestimmten Frequenz verbunden zu sein mit der Autorin: Mia Gatows erstes Buch hinterlässt etwas im Leser. Vor allem auch Neugier und Lust auf die Klarheit statt Rausch, so ein „DAS will ich auch erleben und leben.“
Die Autorin „teilt“ ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und Erkenntnisse in ihren verschiedenen Trinkphasen so offen, so authentisch, als würden wir alle gemeinsam am Tisch der Anonymen Alkoholiker sitzen. In dem Kapitel „Die Auferstandenen“ erklärt sie auch, weshalb sie sich genau in deren Meetings aufgehoben fühlt. („Wenn man lernen will, die Menschen zu lieben, dann sollte man zu den Anonymen Alkoholikern gehen.“). Ihr erster Meetingbesuch war zugleich ihre Befreiung, ihre Kapitulation: Seitdem trank sie nie wieder Alkohol.
Bis dahin hatte sie jahrelang mit Tests versucht, herauszufinden, ob sie schon Alkoholikerin sei, ohne es wirklich genau wissen zu wollen. Weil sie es bereits ahnte. Denn selbst aufgestellte Trinkmengenregeln konnte sie niemals einhalten.
Sie trank nicht täglich. Und nicht am Morgen. Hatte früh keine zitternden Hände. Wohl aber viele, viele fiese Kater-Tage. Nach vielen, vielen durchfeierten Nächten. Durchfeiert in ihrem Falle auch: Wilde Nächte. Sie lebte „Cool-Girl“, mit Wein, Männern und Sex. Rebellisch. Bloß nicht lauwarm und spießig sein.
Nach und nach aber erfüllte sie dies alles nicht mehr. Sie wird seelisch müde, hoffnungslos, orientierungslos. Sie sucht und sucht. Aber wonach?
Ihre Ahnung wird immer stärker: Sie muss den Alkohol weglassen. Aber sie hat Angst davor. Wie soll das gehn? Was dann? Und: Wie soll ich denn etwas nicht mehr wollen können, was ich doch aber wollen will? Und was meint Daniel Schreiber bloß in seinem Buch mit: „Man hört auf, indem man aufhört?“
Viele Jahre reflektiert sie mit sich über das Thema Aufhören. Rekapituliert den Beginn ihres Konsums, die Gründe, und auch ihre Familiengeschichte, denn Oma und Vater starben am Alkohol und auch Generationen vorher. Sie kämpft, ackert, dramatisiert mit dem Thema Alkohol. Irgendwann lässt sie alle stetigen Vorsätze fallen. Und hier, einfach weil es eine der vielen wunderbaren Passagen im Buch ist, mal eine Leseprobe: „In den letzten Monaten meines Trinkens ist es so, als würde ich beginnen, eine schmutzige Scheibe zu putzen. Ich wische immer wieder den Dreck weg, immer wieder versperren die graubraunen Schlieren mir die Sicht, aber ich kann nicht mehr leugnen, dass auf der anderen Seite Licht ist. Ich trinke immer noch, aber konzentriere mich nicht mehr darauf … Ich konzentriere mich auf die Landschaft hinter der schmutzigen Scheibe. Manchmal bleibe ich nüchtern. Immer, wenn mir das gelingt, fühlt es sich stark und richtig an.“
Das ist der Ort, zu dem sie hinwill. Denn den brauche man, wenn man von einem Ort wegwill, sagt sie. So weise, als wäre sie nicht Mitte 30, sondern säße schon weißhäuptig im Lehnsessel vorm bullernden Öfchen.
Und dann ist sie das erste Mal bei den AA. Und kapituliert …
Auch über andere Dinge sinniert sie oder besser, klärt auf: Was ist denn ein Blackout tatsächlich? Was macht Dopamin im Gehirn? Warum ist Alkohol legal und normal? Und so weiter …
Mia beschreibt ihre neue Klarheit, ihr nüchternes Da-Sein mit berauschenden Worten. Euphorisch fast. Aber behauptet nie, dass es einfach ist. Denn das erfährt sie im Laufe der Zeit natürlich auch. Jetzt ist das nämlich so: „Du musst alles fühlen, was du dir selbst antust, musst alles hören, was du dir selbst erzählst … es gibt keinen Ausknopf mehr, keine Ablenkung, keine Betäubung, keinen Umweg. Nur dich und dich und dich allein.“
Leben eben.
Und anderswo beschreibt sie es als hell, unmittelbar, „wie eine riesengroße, bienensummende und blumensatte wiese im Mai.“
Lassen Sie sich bitte ruhig dahin entführen, liebe LeserInnen, lesen Sie …
Anja Wilhelm
MIA GATOW, Rausch und Klarheit, Goldmann, 304 Seiten, ISBN: 978-3-442-31753-0, 18 Euro
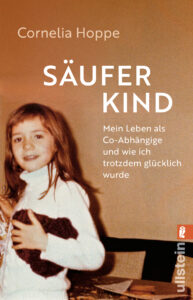 Säuferkind
Säuferkind
So brutal, wie dieses eine Wort klingt, war der Alltag für die kleine Conni tatsächlich auch …
Die Autorin beschreibt ihr Aufwachsen mit alkoholsüchtigen Eltern und ihr späteres erwachsenes Leben mit einem trinkenden Ehemann. Sie war damit eines von hunderttausenden Kindern in Deutschland, früher und heute, die unter solchen Bedingungen groß werden mussten und müssen – und gibt mit dem Buch allen von ihnen eine Stimme.
Auf eine sachliche, fast nüchterne Weise erzählt sie aus ihrem Alltag als Säuferkind: Von unbeheizten und verkommenen, dreckigen Wohnungen, Stromabklemmungen und hungrigen Tagen in Hamburgs Armeleute-Vierteln in den 70er Jahren, von unzähligen Umzügen wegen Mietschulden, von Hänseleien und Mobbing durch Mitschüler. Das Allerschlimmste aber: Von Mutter und Vater, die in den Kneipen rundum zuhause sind und meist nur noch torkelnd den Weg zurückfinden, sich des nachts brüllend streiten und sogar auch schlagen.
Schon mit zehn Jahren flüchtet Conni manchmal allein durch das dunkle Hamburg mit dem alten Kinderrad zu ihren Brüdern, die längst ausgezogen sind. Sie fühlt sich einsam. Schämt sich vor den Mitschülern, Lehrern, Nachbarn, für sich und ihre Eltern. Daheim wird sie früh selbstständig: Will sie essen oder saubere Kleidung oder ein ordentliches Klo, muss sie das alles selbst erledigen. Einkaufen, kochen, putzen, waschen. Immer in Angst: Trinken sie heute wieder? Wird wieder jemand aggressiv? Immer in Sorge: Stürzt Mutter wieder? Oder verliert sie ihren Job, dann muss wieder umgezogen werden? Wie wird sie sich bei der Elternversammlung benehmen oder gar vor meinen Freunden?
Eine Kindheit in ständiger Habachtstellung, ohne liebevolle Zuwendung, ohne Geborgenheit, ohne sich sicher fühlen zu können, Selbstwert gleich Null.
Bestimmte „Antennen“ und Verhaltensweisen bleiben ihr lange erhalten, sie sind ins Unterbewusstsein programmiert. Vielleicht auch deshalb verliebt sie sich in Andreas, sie gründen eine Familie, haben zwei Töchter – aber auch er trinkt. Zu viel. Da es noch nicht soo schlimm wie bei ihren Eltern ist, sieht sie das noch nicht als Problem an. Aber als die Freunde und Bekannten sich abwenden, vor denen sie ihn immer, sich schämend, entschuldigt hat, als er irgendwann sogar handgreiflich wird und die Kinder nur noch jähzornigen Streit von früh bis spät miterleben müssen, erkennt sie ihr Muster: Sie ist co-abhängig. Und auch ihre Töchter sind es bereits, so wie sie damals als Kind.
Es fällt ihr dennoch schwer, sich zu trennen, denn Andreas ist der Verdiener der Familie, sie hat kein Geld, noch keinen Job, wie soll sie es schaffen? Aber der Entschluss steht fest. Und sie schafft es irgendwann.
So, wie sie es heute beschreibt, sehr plastisch durch Detailbeschreibungen und gut – aber oft nur mit schwerem Herzen – zu lesen, klingt es nie wie ein Vorwurf an ihre Eltern oder an Andreas. Sie beschreibt ihr Leben nicht anklagend. Sie liebte ihre Eltern immer trotz alledem und sie verachtet auch ihren Partner nicht. Sie weiß heute, Sucht ist eine Krankheit, die sich niemand selbst ausgesucht hat.
Sehr wohltuend finde ich die wirklich positive Ausstrahlung des Buches. Aus tatsächlicher Düsternis wird Licht, Cornelia Hoppe nimmt uns diesen Weg mit als LeserInnen. Sie arbeitet heute wieder als Goldschmiedin, selbstbestimmt, wie sie oft betont. Ihre Töchter sind ebenfalls zu selbstbewussten jungen Frauen herangewachsen. Und im Anhang, dem letzten Kapitel, wendet sie sich direkt mit zahlreichen Hilfestellungen an die Kinder suchtkranker Eltern und an Co-Abhängige.
Danke für diese Einblicke und Ausblicke …
Anja Wilhelm
CORNELIA HOPPE, Säuferkind, Ullstein Taschenbuch, 272 Seiten, ISBN 9783548069951, 14,99 Euro
Band 1 der Trilogie von Thomas Korsgaard
Hof
Der erste Band der Trilogie von Thomas Korsgaard, von den dänischen Lesern hochgelobt, liegt nun in deutscher Sprache vor.
Der 1995 geborene Senkrechtstarter des dänischen Literaturbetriebs schrieb diesen ersten Band Hof im Alter von 21 Jahren. Tue lebt auf einem Bauernhof im ländlichen Nirgendwo zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Geschwistern sowie einer Menge Hunden. Auf dem Hof scheint es Milchviehwirtschaft zu geben, da regelmäßig der LKW der Molkerei vorbeikommt und in der ersten Zeit auch der Abdecker, um verendete Kälber abzuholen, später werden diese gleich auf dem Hof verbrannt. Es ist womöglich kein Idyll, in dem Tue, zu Beginn etwa zwölf Jahre alt, lebt. In 53 Kapiteln werden Episoden aus dem Leben des heranwachsenden Protagonisten erzählt, am Ende ist er vielleicht 16 Jahre alt.
Der vom Verlag so bezeichnete Roman ist bemerkenswert sparsam mit Beschreibung und Erklärung von handelnden Personen und Orten, an denen die Fragmente spielen. So kann sich die Leserin, der Leser nur ein schemenhaftes Bild vom heimischen Bauernhof machen, von der Landschaft, die ihn umgibt. Auch werden Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Omas und Großmütter nur skizzenhaft dargestellt. Daher ist es mühsam, die geschilderten Ereignisse genauer einzuordnen und die Charaktere der Mitmenschen einzuschätzen. Auch Tue lässt die Leserin, den Leser nur spärlich an seinen Gedanken teilhaben. „Hof“ ist der erste Teil einer Trilogie, der letzte Teil der deutschsprachigen Ausgabe wird im Herbst 2025 erscheinen, wir werden dann über die zwei bis dahin erschienen Bände berichten. Die Geschichten bilden eventuell die Puzzleteile, die zu einem schlüssigen Roman zusammengefügt werden könnten. Wir sind gespannt, wie es mit dem halbstarken Tue und seinem Autor weitergeht.
Torsten Hübler
THOMAS KORSGAARD, Hof, 288 Seiten, geb., Kanon Verlag, ISBN 978-3-98568-128-0, 25,00 Euro
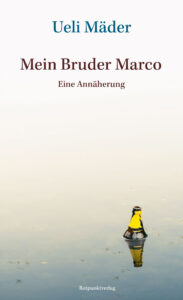 Mein Bruder Marco
Mein Bruder Marco
„Eine Annäherung“. So lautet der Untertitel des Büchleins …wieso eigentlich Annäherung, sie waren doch Brüder?
Autor Ueli Mäder, ein angesehener Professor für Soziologie in der Schweiz, schrieb es zehn Jahre nach dem Tod seines Bruders Marco. Der mit nur 66 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben war. Vermutlich eine Folge seiner Alkoholsucht.
Es ist kein herkömmlicher Roman, den man entspannt und gespannt in einem Ritt lesen und nicht aus der Hand legen kann. Sondern die Zeilen wollen langsam zur Kenntnis genommen werden, brauchen Pausen zum Denken oder Sinnieren. Oder eben auch zum Nochmal-Nachschlagen=Googlen. Zum Beispiel nach der 68er-Bewegung, in der Marco sich zuhause fühlte …
Kurzum: Es ist eine Art Brief an Marco. In Du-Form. Keine Hymne, keine Ode. Sondern eine Art Aufarbeitung, eine brüderlich dankbare Trauerbewältigung, ein Loslassen, so lautet auch das letzte Kapitel.
Der Autor befragt seine Erinnerungen, gemeinsame Erinnerungen und es schimmert immer auch eine Frage, D I E Frage hindurch: Wie konnte aus einem Menschen voller Talente, einem geborenen Sonntagskind, dem alles zuflog, der sogar in der Handballnationalmannschaft spielte, Theologie studierte und philosophierte, der Heraklit, Jean-Paul Sartre, Erich Fromm, Bertolt Brecht, Kästner diskutierte, unbedingt die soziale Ungleichheit abschaffen wollte und Kriege sowieso erst recht … ein Trinker werden? Ein Randständiger, wie man in der Schweiz sagte? Und das mit einem Vater, der als Alkoholfürsorger gearbeitet hatte (aber auch mit jenen vor ihm, die Säufer waren) …
„Wie andere, die zuerst ,himmelhoch jauchzend‘ die Welt aus den Angeln hieven wollten und dann ,zu Tode betrübt‘ abstürzten“, konstatiert der Autor, der Bruder.
Marco, weil er den Militärdienst verweigerte, landete für ein paar Monate im Gefängnis. Arbeitete dann als Sozialarbeiter. Bis er selbst zu den Randständigen gehörte durch seine Sucht. Immerhin behielt er seine Wohnung, seine dunkle, verrauchte Höhle voller leerer Weinflaschen, auch die vier Geschwister helfen ihm dabei und bezahlen manchmal sogar seine Anschreibzechen. Er schafft eine monatelange Therapie und bleibt „einigermaßen“ trocken für Jahre. Er liebt die Natur (auch da hat er Flaschenverstecke), verdingt sich mal da, mal dort, schreibt, lebt vom Honorar, oft aber auch von der Hand in den Mund. Und hilft weiter denen, denen es ähnlich ergeht, so gut er kann. Und immer noch philosophiert er, mit sich, mit Freunden, mit Bruder Ueli: „Was machen wir aus dem, was die Gesellschaft aus uns macht?“ „Kosmos …: ein geordnetes Chaos oder eine chaotische Ordnung?“ Und sooo vieles mehr.
Bis der Krebs ihn buchstäblich erstickt.
Mit „Annäherung“ ist wohl gemeint, den Bruder im Nachhinein besser verstehen zu wollen, vor allem auch die Sucht. Heute würde der Autor als Bruder einiges anders machen, statt an Würde und Wille zu appellieren, sagt er. Nämlich: „Heute würde ich die neuere Suchtforschung mehr berücksichtigen und vor allem dir noch besser zuhören.“
Mich hat das Buch sehr traurig gestimmt, liebe LeserInnen, so einige von Marcos Mitstreitern werden ebenfalls erwähnt, wie sie kurz vor oder nach ihm starben. An Krebs. Eine Sommerurlaubslektüre ist es wohl eher nicht. Und will es auch nicht sein …
Anja Wilhelm
UELI MÄDER, Mein Bruder Marco – eine Annäherung, Rotpunktverlag, 192 Seiten, Gebunden, ISBN 978-3-03973-021-6, 26 Euro
 Abrechnung mit der Krisenpolitik
Abrechnung mit der Krisenpolitik
Krise
Dr. Ulrich Schneider, von 1999 bis 2024 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, hat zum Abschied von seinem Leitungsposten eine Bestandsaufnahme zum Zustand der Gesellschaft in der Bundesrepublik im Schatten der multiplen Krisen seit 2020 vorgelegt.
Um es vorweg zu nehmen, der studierte Diplom-Pädagoge und Soziallobbyist kommt in seinem Vorwort zu dem Ergebnis: „Deutschland stand vor Herausforderungen. Und hat versagt.“ Beginnend mit der Corona-Krise und den Reaktionen der Politik der Regierungskoalition aus CDU und SPD werden die aufeinanderfolgenden und teilweise überlagernden Störungen, die Inflation, der Angriffskrieg Russlands, Energiepreisexplosion und deren Management durch die Koalitionsregierung aus SPD, Grüne und FDP, behandelt.
Im ersten Kapitel werden Zahlen und Daten präsentiert und sozialpolitisch eigeordnet und sortiert. Diese werden chronologisch dargestellt und kommentiert, das sind unter anderem Arbeitslosenzahlen, Armutsquoten, Sparquoten, aber auch die hunderte Milliarden Euro für Schutzschirme, Konjunkturprogramme, Mehrwertsteuerabsenkung, Energiepauschalen, Inflationsausgleich, Tankrabatt, Neun-Euro Ticket und andere Hilfen. Auch die Gewinner der Verwerfungen, nicht nur unter den DAX-Konzernen, werden benannt. Die Anzahl der Millionäre in Deutschland stieg beispielweise in der Coronazeit von 2019 bis 2021 von 1,47 Millionen auf 1,63 Millionäre. Dabei verwendet er Begriffe und Kategorien wie zum Beispiel „Krise“, „die Armen“, „die Reichen“, ohne diese näher zu definieren, für manche ist es eine Krise, wenn z.B. Benzin über zwei Euro/Liter kostet, für andere ist es nur ärgerlich und für ganz andere ist das völlig irrelevant. Bei der Bewertung der einzelnen Maßnahmen der Regierungen nimmt er die Perspektive von Hartz- IV-Empfängern, jetzt Bürgergeldempfänger, ein und prüft die Maßnahmen auf ihre soziale Ausgewogenheit. Sein Fazit: „Es waren mal wieder die Armen diejenigen, die wirklich noch ärmer wurden …“
Im zweiten Teil, beginnend mit dem zweiten Kapitel, thematisiert Schneider das Versagen des linken Politikspektrums beim Umgang mit dem Regierungshandeln. Die Gewerkschaften als Partner zur Beendigung der Armut werden genauso wie die sich links nennenden Parteien als untauglich bewertet. Er setzte sich mit sozialen Bewegungen, die sich aus dem Internet rekrutieren, auseinander und nennt sie „Scheinriesen“, da, obwohl zigtausende Nutzer die Hashtags und Aufrufe der Aktiven liken und folgen, lassen sich auf der Straße bei Demonstrationen oder bei Versammlungen nur einige wenige blicken. Einige wirkungsvolle Verbündete bei der gesellschaftlichen Armutsabwehr sieht er bei wenigen Initiativen und Verbänden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband wird hier mehrfach erwähnt. Auch im dritten Kapitel wird die Abwesenheit einer schlagkräftigen Armutslobby beklagt und im Gegensatz zu den Wirtschafts- und den Arbeitsnehmerlobbyisten mit ihren Machtfaktoren, Produktionsverlagerung und Arbeitskampf, die Machtlosigkeit der Armutslobby konstatiert. Neben egoistischen Wirtschaftslobbyisten und Gewerkschaften sieht er das Fortdauern der Armut in Deutschland auch in der Zusammensetzung der Parlamente begründet, viele Rechtsanwälte, Juristen und Beamte, wenig Handwerker, Sozialarbeiter und Arbeitslose. Wenn die Menschen als Abgeordnete in die „Berliner Blase“ eintauchen, haben sie, nach Meinung des Autors, einen verengten Blick mehr für die Nöte der normalen Menschen, dies gipfelt in der Aussage „Und wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht bekanntermaßen in jedem Problem einen Nagel.“ Neben den Mitgliedern des Bundestages bekommt die „Professorenschaft“ auch ihr Fett weg. Im vierten Kapitel will er mit der Mär aufräumen, dass Deutschland ein „Eins-a-Sozialstaat“ ist, auch mit der Mär von der solidarischen Gesellschaft rechnet er ab. Hier trauert er der sozialen Marktwirtschaft Westdeutschlands hinterher, als die Renten noch bei 68 Prozent statt 48 Prozent lagen, auf das Arbeitslosengeld die Arbeitslosenhilfe folgte, die immer noch über der Sozialhilfe lag. Es herrschte Vollbeschäftigung und es gab jede Menge Sozialwohnungen, BAföG war ein Zuschuss und kein Darlehen und ging an 40 Prozent und nicht elf Prozent der Studierenden. Anmerken möchte ich, man nennt das heute Wirtschaftswunder. Er lamentiert über Spendenbereitschaft und Ehrenamt, kommt auch auf Konrad Adenauers Lastenausgleichsgesetz von 1952 (Das Gesetz sollte nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg den Aufbau der BRD und die Integration der „Vertriebenen“ in Gang setzen und war eine Vermögensabgabe d. Verf.). Auch der Gerechtigkeitsbegriff im Steuersystem wird zerlegt: „Unser Gerechtigkeitsbegriff ist in den meisten Fällen nicht mehr nur kleinkariert, sondern schon Pepita.“ Davon leben über 100.000 steuerberatende Kanzleien mit unzähligen Beschäftigten. „Bei Hartz IV regiert die gleiche Kleinkariertheit, nur in umgekehrte Richtung“, regt sich Schneider auf. Er vertritt hierbei eine allumfassende Solidaritäts- und Gerechtigkeitstheorie, die auf Großmut, Güte und Barmherzigkeit basiert. Dabei illustriert er seine Forderung mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus dem Matthäus-Evangelium der Bibel.
Im vorletzten Kapitel nimmt sich der „Sozialexperte“ (Klappentext) der Vorurteile und Widersprüche an. Er beschreibt die „Kampagne“ von CDU und CSU gegen das 2023 eingeführte Bürgergeld und das Schüren von Vorurteilen gegenüber Bürgergeldempfängern.
Im letzten Kapitel wird die Lösung all der vom Autor benannten Probleme präsentiert, die sich nicht als überraschend neu herausstellen.
Der vorliegende Titel ruft einem wieder die fast vergessene, schwere Corona-Zeit ins Gedächtnis. Mit der Aufzählung der ganzen von den Regierungen eingesetzten Mittel und deren (Aus-)wirkungen begibt sich Schneider an die Aufarbeitung der Pandemie und der anderen politischen Störungen der letzten Zeit. Dass er das radikal subjektiv unter dem Blickwinkel der Armutsbekämpfung vornimmt, ist kein Makel. Er versucht wenigstens eine Einordnung und Bewertung des gesamtgesellschaftlichen Managements der Krisen, diese in allen Bereichen zwingende Aufarbeitung steht bei den meisten privaten wie öffentlichen Akteuren noch aus. Schneiders Bestandsaufnahmen und Vorschläge zur Lösung der von ihm konstatierten Armutskrise sind bei weitem nicht so radikal, wie es der Untertitel suggeriert. Ein wichtiger Impuls zur Evaluierung des bundesdeutschen Krisenmanagements.
Torsten Hübler
ULRICH SCHNEIDER, Krise, Das Versagen einer Republik, 176 Seiten, Klappenbroschur, Westend Verlag, ISBN 978-3-86489-454-1, 20,00 Euro
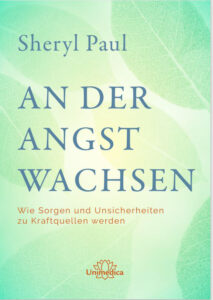 An der Angst wachsen
An der Angst wachsen
Ich will die Angst aber doch einfach nur weghaben, dachte ich so, als ich diesen Titel las. An ihr zu wachsen würde ja bedeuten, ich muss irgendwie weiter mit ihr leben … weg soll sie!
Doch mit jeder Buchseite mehr fühlte ich – chronisch angstgestört seit der Kindheit mit einer Million sorgenvollen „Was, wen …“-Bedenken und Gedankenkreiseln am Tag – mich mehr verstanden. In die Arme genommen. Getröstet und vor allem bestärkt, einen ganz anderen Weg zu probieren: Nämlich die Ängste und Sorgen gar nicht weghaben zu wollen! Ein ganz neuer Gedanke, nicht wahr? Den muss man erstmal zulassen.
Sheryl Paul ist eine sehr bekannte amerikanische Psychologin, die in Kursen, Büchern, Beratungen und Therapiesitzungen schon tausenden angstgestörten Menschen helfen konnte.
Na okay, ja, das muss man nicht glauben. Darf man aber … Inzwischen finde ich logisch, was sie empfiehlt: Der Angst, wann immer sie auftaucht und die Brust zusammenschnürt, den Kopf verspannt, den Puls hochtreibt, Schlaf verhindert, Endlosgedankenschleifen erzeugt, ganz anders zu begegnen: Nämlich ihr direkt und neugierig Aufmerksamkeit zu schenken. Sie als Geschenk zu sehen, denn sie trägt eine wertvolle Botschaft.
Laut Sheryl Paul (die auch Expertin für die Tiefenpsychologie nach Jung ist) ist Angst ein Platzhalter für Gefühle. Gefühle, die sich im Inneren stauen, wenn sie nicht gefühlt werden, sondern versteckt und verdrängt. Ob nun Trauer, Kummer oder Wut und Groll, Neid oder Eifersucht. Ungeweinte Tränen. Wir können uns von der Angst genau dorthin führen lassen und vielen Dingen im Unterbewusstsein, die uns im Freisein, Selbstwertigfühlen behindern, auf die Spur kommen. Im Endeffekt seelisch gesunden, wir selbst werden.
Die Autorin beschreibt viele Beispiele von Patienten und auch aus ihrem Leben, der Leser kann sich wiederfinden. Und gibt viele praktische Hinweise und Übungen, anwendbar, wo immer man auch gerade ist. Eine kleine davon zum Beispiel: Tonglen Sie! Das ist eine buddhistische Atemtechnik, ganz leicht.
Das klingt insgesamt jetzt, so kurz zusammengefasst, vielleicht nicht sehr überzeugend?
Ich lade Sie deshalb ein, meinen Text in der Hausdestille auf S. X dazu zu lesen, „Miss Ängstlichkeit auf neuer Spur“, vielleicht verstehen Sie dann, dass ich diese Einstellung, diesen Weg, mit der Angst umzugehen, statt sie mit abhängig machenden Medikamenten oder gar Cannabis kurzzeitig „verschwinden“ zu lassen, für einen gesunden möglichen halte. Eins noch: Ich habe inzwischen schon mal keine Angst mehr vor der Angst, schäme und verdamme mich nicht mehr dafür, vergeude keine Energie mehr damit, sie als Feind zu bekämpfen. Nö. Komm her, bleib da und erzähl mir, was du sagen willst … eher so.
Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dieses Buch gefunden zu haben. Vielleicht Sie irgendwann auch?
Anja Wilhelm
SHERYL PAUL, An der Angst wachsen, Narayana Verlag, 320 S., kart., 19,80 Euro, ISBN: 978-3-96257-326-3
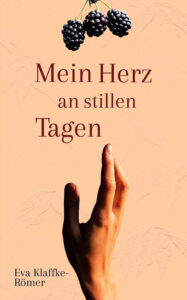 Aufwachsen mit einem trinkenden Vater
Aufwachsen mit einem trinkenden Vater
Das Buch hat mich sehr erschüttert.
Eva Klaffke-Römer, heute um die 60, hat über einige Jahre hinweg ihre Kindheit darin aufgearbeitet, fast als eine Art Therapie. Ihr Vater, Dachdecker von Beruf, Biertrinken war damals normal auf dem Bau, kam meist schon betrunken nach Hause und soff dort weiter. Auch Schnaps. Und wurde meist jähzornig und aggressiv. Besonders gegen die Mutter auch gewalttätig. Sie und die vier Kinder lebten in ständiger Angst, Sorge, Anspannung, beobachtend, Böses immer erwartend: Was passiert heute, wenn er zur Tür reinkommt? Lauter, zorniger Streit bis tief in die Nacht? Umherfliegendes, zerschellendes Geschirr? Schluchzende, gar verletzte Mutter?
Angst statt Harmonie, Hass statt Liebe. So wuchs Eva auf. Auch die Mutter, die zumindest die Kinder versorgt, so gut es ihr gelingt, verbittert und kann nicht geben, was die Kinder dringend brauchen: Gütige Fürsorge, Liebe, Sicherheit, Geborgenheit. Als die Mutter eines Nachts vor dem Vater um ihr Leben wegrennt, barfuß im Nachthemd, gibt es die Familie nicht mehr. Die vier Kinder werden in einem diakonischen Heim groß.
Vielleicht bewegt das Buch alkoholabhängige Eltern besonders. Ich habe beim Lesen oft denken müssen: Oh Gott, hoffentlich hat sich dein Sohn nicht ebenso gefühlt, als du selbst getrunken hast! Vielleicht sind es meine großen Schuldgefühle, weshalb ich mich mit dem Buch doch manchmal recht unwohl fühlte, mag sein. Oder ist ganz sicher so. Dafür kann das Buch aber nichts.
Vielleicht liegt es auch mit daran, dass es ein zutiefst trauriges Buch ist, sein musste. Fast ohne Licht. Ohne Frohheit. Voll dunkler Sehnsucht nach etwas, was Eva immer vermisste: Das schöne, liebevolle, friedliche Familienleben der anderen. Und schuld daran war, das übernahm sie als Kind von ihrer Mutter, der Vater. Der Feind. Fast fühlt sich so manches Kapital für mich an wie eine Anklage … aber es ist aus damaligem Kinderleben geschrieben und wie soll ein Kind verstehen, was da passierte. Vielleicht findet sich dann im zweiten Teil, an dem die Autorin gerade schreibt, eine Spur von Verstehen und Vergebung gegenüber dem alkoholKRANKEN Vater, gegenüber dem Leben und der Zeit, in die sie nun mal ungefragt geboren wurde (damals ohne Verhütungspille war so manches Kind kein geliebtes Wunschkind, denke ich), gegenüber sich selbst auch, denn Gefühle wahrzunehmen, zu zeigen und zu kommunizieren hatte sie nie lernen können, das erschwerte ihr später selbst das Leben.
Warum hat sich die Mutter nicht frühzeitig getrennt? Warum ist der Vater nicht in ein Entziehungsheim gegangen? Warum hat die Mutter ihre Kinder ins Heim geschickt? Viele Fragen stellten sich mir aus der Sicht eines selbst alkoholerkrankten Menschen.
Aber nun lasse ich Sie alleine mit dem Buch, liebe Leserinnen und Leser. Ich finde es absolut wichtig, dass wir erfahren dürfen, wie Kinder suchtkranker Eltern sich fühlen, was sie vermissen, wie sie leiden und dass man zumindest dort, wo man selber kann, Hilfe anbieten und geben muss. Und es könnte auch eine Aufforderung sein, vielleicht die Vergangenheit gemeinsam mit dem eigenen Kind nochmals oder überhaupt erst einmal gemeinsam zu besprechen?
Anja Wilhelm
EVA KLAFFKE-RÖMER, Mein Herz an stillen Tagen, Biografie Verlag, TB, 200 Seiten, ISBN: 978-3-937772-37-0, 14,90 Euro
Vollbad im Gesinnungsschaum
Klaus Bittermann, Förderer und Verleger des 2019 an Leberzirrhose verstorbenen Wiglaf Droste, Autor, Musiker, Satiriker und Alkoholiker, hat sich die Mühe gemacht, das Werk des Sprachberserkers unter dem Aspekt der Sprachkritik zu durchforsten. Das lange und sehr breite publizistische Spektrum des ehemaligen
„Rheinsberger Stadtschreibers“ machte dies wohl zu einer ausufernden Tätigkeit. In seinen Glossen nimmt Droste die geistlose Verwendung der Sprache in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Werbung aufs Korn. Er macht sich über die Institution „Unwort des Jahres“ ebenso lustig wie über die sprachliche Überkorrektheit einiger politischer Eliten. Auch zeitgeistliches Geschwafel kommt bei ihm auf die humoristische Schippe. Sehr schön illustriert Droste das in der jetzt wieder aktuellen Glosse „Public Viewing“. Er zeigt auf, dass dieser Begriff beileibe nicht „öffentliches Anschauen“ bedeutet, sondern die öffentliche Aufbahrung eines Verstorbenen … Neben der sachlich korrekten Kritik an der heutigen Sprachschluderei ist das Werk aber durch und durch humorgetränkt. Der Autor zeigt dem an Sprache interessierten Menschen, dass man kein Oberlehrer sein muss, um sich über die wichtigste Kommunikationsform des Menschen
Gedanken zu machen. Witz und Ernsthaftigkeit gepaart zum Wohle der Sprache.
Torsten Hübler
WIGLAF DROSTE
Vollbad im Gesinnungsschaum
304 Seiten, Pb., Edition Tiamat,
ISBN 978-3-89320-303-1, 22,- Euro
Über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie
Ekstasen der Gegenwart
Die beiden Journalisten Hanske und Sarreiter befassen sich mit dem menschlichen Phänomen der Ekstase. Laut Wikipedia beschreibt das Wort Ekstase „psychische Ausnahme-Zustände … Sie werden von den Betroffenen als dramatische Zustandsveränderungen des Bewusstseins beschrieben.“ Beginnend mit den dionysischen Festspielen im Altertum geht es durch die Geschichte bis hin zu den titelgebenden Ekstasen der Gegenwart.
In ekstatische Zustände können Menschen durch Meditation, Musik, Tanz, religiöse Erfahrungen und andere Verrichtungen gelangen. Meist soll dieser Ausnahme-Zustand der Psyche aber durch Rauschgifte herbeigeführt werden. Wobei nicht jeder Rausch zu einer Ekstase führt. Die beiden Verfasser geben einen Überblick über die gängigsten Rauschmittel und setzen sich mit dem heute stattfindenden Optimierungsbestreben des Individuums auseinander, das vielerorts auf der Nutzung geringer Mengen Rauschgifts beruht (Microdosing), um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Und wo es einen (vermeintlichen) Bedarf gibt, gibt es auch, nach marktwirtschaftlicher Logik, eine Erfüllung. Es gibt eine Ekstase-Industrie. Die Auswüchse sind z.B. sündhaft teuer vermarktete Reisen zu indigenen Schamanen in den Urwald, um mittels der dort geläufigen Rauschgifte, über alle Kulturgrenzen hinweg, Ekstasen oder zumindest Räusche zu erleben.
Die Neubewertung psychotroper Substanzen wie LSD, Psylocybin, Ecstasy und Ketamin zur Behandlung psychischer Erkrankungen durch Teile der Wissenschaft trifft auf eine Drogenpolitik, die Rauschgiften gegenüber sehr restriktiv ist, mit den bekannten Ausnahmen: Alkohol und Nikotin. Mittlerweile ändert sich aber das Klima (siehe die überhastete Legalisierung von Cannabis in Deutschland) und es stehen in Deutschland schon die ersten Unternehmen für den „Markt für psychedelische Pharmaprodukte“ bereit. Auch Hanske und Sarreiter plädieren für eine Entkriminalisierung dieser Gifte, da sie angeblich nicht abhängig machen.
Ein interessanter Einblick in die gegenwärtige Verstörtheit der westlichen Gesellschaften, die sich durch die globalisierten Produktivitätszwänge mittels Rauschgiften auf immer höhere Leistungsebenen hieven muss. Um dann mittels psychotroper Substanzen wieder Entspannung zu finden. Jede Stufe der Produktion entwickelt auch die entsprechenden Rauschgifte, um die neuen Produktionsformen zu ermöglichen. Die Industrialisierung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert war ohne massenhaft verfügbaren und billigen Alkohol für die Arbeitnehmerschaft nicht denkbar. Wer einen Blick in die nahe, mögliche, drogenoptimierte Zukunft werfen will, dem sei dieser gut geschriebene Titel sehr empfohlen.
Torsten Hübler
PAUL-PHILIPP HANSKE & BENDIKT
SARREITER
Ekstasen der Gegenwart
351 Seiten, geb., Matthes & Seitz, ,
ISBN 978-3-7518-0393-9, 28,- Euro
Ich habe es geschafft!
„Ich möchte das Buch recht kurzhalten, so dass auch Suchtkranke es lesen und verstehen“, erklärt Autor Manfred Dosch in seinem Vorwort. Und tatsächlich: Es ist ein nur 88 Seiten zählendes Büchlein, mit großer Schrift und großem Zeilenabstand. In einfacher Sprache verfasst.
Denke ich selbst an meine schlimmsten nassen Zeiten zurück, in denen, wenn ich überhaupt in ein Buch schaute, die Zeilen verschwammen und die Inhalte kaum nachvollziehbar waren … finde ich das eine gute Idee von ihm. Denn genau diese Leserschaft will er erreichen.
Der Autor, gelernter Garten- und Landschaftsbauer, erzählt zum Einstieg, wie er süchtig wurde: Vom Feierabendbier bis zu zwei Flaschen Wodka täglich, als er obdachlos wurde. Entgiftung, Therapeutisches Wohnen. Seit sieben Jahren ist er zufrieden trocken und arbeitet als Friedhofswärter.
Aber er hält sich nicht lange auf mit der Erzählung seines Lebenslaufs. Schade eigentlich, ein bisschen mehr hätte ich schon gerne noch gewusst. Wichtiger sind dem Autor aber die Informationen, die er Betroffenen (übrigens auch deren Angehörigen und Freunden) unbedingt vermitteln will: Wie entsteht Sucht, wie bemerkt man sie an sich und am anderen, was richtet Alkohol im Körper an (Leber, Bauchspeicheldrüse usw.), was erwartet mich, wenn ich entgiftet habe bis hin zum Notfallkoffer und eigenen Nüchternbleib-Erfahrungen. Dazu bedient er sich auch einiger Wissensquellen und zitiert viel.
Er weist anfangs deutlich darauf hin, dass er kein Therapeut ist, sondern als Betroffener schreibt für andere Betroffene. Und das ist ihm gelungen, finde ich, noch nasse Alkoholkranke können sich darin wiederfinden, erkennen und aber auch Hoffnung schöpfen. Hut ab, Manfred Dosch.
Anja Wilhelm
MANFRED DOSCH
Raus aus der Alkoholfalle
Ich habe es geschafft
Reichel Verlag, Taschenbuch, 12 Euro
ISBN-13: 9783910402096
ISBN-10: 3910402097
Unsere blauen Nächte –Wir trinken, bis die Welt erwacht
Ja, auch als 61-jährige Langzeittrockene habe ich dieses Jugendbuch (ab 12 Jahre) wie gebannt gelesen! Fast wie ein Krimi spannend geschrieben, die Thematik natürlich sehr nahe und hoch wichtig: Komasaufen. Wie ticken Kinder und Jugendliche, die sich betrinken bis zur Alkoholvergiftung? Warum tun sie das? Und wie kann geholfen werden? Das alles konnte ich tatsächlich herauslesen …
Die Geschichte: Oscar ist 16 geworden. Und darf sich endlich alleine Bier kaufen. Vorher wurde ein älterer Kumpel immer dazu beauftragt. Gefeiert wird mit der Trinker-Clique. Die Trinkspiele mit von Zuhause abgezweigten harten Getränken und Eigen-Mischungen haben Handgreiflichkeiten, Filmrisse und die Misshandlung eines arglosen streunenden Hundes zur Folge, der wird betrunken gemacht. Ein Kumpel landet mit Alkoholvergiftung in der Klinik. Oscar selbst muss zum Polizeiverhör, zur Jugendgerichtshilfe, Suchtberatung und Sozialstunden ableisten. Anfangs tut er das natürlich nur absolut widerwillig. Es fällt ihm sehr schwer, die Einladungen seiner Saufkumpane in die „Blaue Lagune“ abzusagen: „Ich bekam sofort eine trockene Kehle, wie ein Phantomschmerz, weil etwas fehlte, etwas Kühles, Feuchtes, Prickelndes. Etwas … das mich mit anderen verband und von Einsamkeit befreite. Etwas, das mich mutiger machte und fröhlicher. So eine Art Allheilmittel.“ Er wird mehrfach rückfällig. Sagt sich dann aber doch mühselig von der Trinker-Clique los, findet Hilfe bei neuen Freunden und gestaltet dann sogar einen Blog übers Nichttrinken.
Den Hund, Süffel genannt, den er einst quälte, trifft er wieder auf dem Gnadenhof, auf dem er seine Sozialstunden leistet – und sie werden Freunde. Endlich jemand, der ihn ohne Vorbehalt liebt, so wie er ist. Tja, wo sind seine Eltern? Vater hat immer Champagner im Kühlschrank, geht fremd und kontrolliert und bevormundet nicht nur Oscar, sondern auch die Mutter. Oscars Schwester ist bereits aus dieser Zerrüttung geflohen. Oscar betäubte sich mit Alkohol …
Ich glaube – und ich wünsche es dem Buch und seinen LeserInnen –, dass Sprache, Schreibstil, Szenen, Situationen und Denkweisen tatsächlich vom Zielpublikum angenommen werden.
Die Autorin ist übrigens selbst Mutter, arbeitet für Film, Fernsehen, Theater und schreibt Jugendbücher, weil: „Mein größter Wunsch ist es, die Seelen der Kinder zu berühren und weiterzugeben, was mir im Leben wichtig geworden ist“, sagt sie auf ihrer Webseite.
Anja Wilhelm
ANNETTE MIERSWA
Unsere blauen Nächte
Loewe Verlag
240 Seiten
ISBN 978-3-74320-1454-5
9,95 € (D)
Herr Sonneborn bleibt in Brüssel
Am 9. Juni ist Europawahl, gehen Sie hin!
Der Satiriker Martin Sonneborn bewarb sich mit seinem Realsatire-Projekt „Die Partei“ bei den Europawahlen 2014 um einen Sitz im Europaparlament. Dank der Wähler und dem Fehlen einer Sperrklausel gelang es ihm. Am Ende der fünfjährigen Legislatur legte er mit dem Titel „Herr Sonneborn geht nach in Brüssel“ den Wählern und Lesern Rechenschaft über seine gutdotierte Tätigkeit im EU-Parlament ab. Nun hat er die zweite Legislatur geschafft und referiert über diese Wahlperiode in seinem vorliegenden Bericht.
Mit 2,4 Prozent der Stimmen zog „Die Partei“ erneut ins EU-Parlament ein, neben Herrn Sonneborn durfte noch ein zweiter, Nico Semsrott, an der EU-Sonne für Die Partei Platz nehmen, Semsrott wird der Partei aber im Laufe der Zeit abhandenkommen. Dies vorausgeschickt, damit man den Kontext der Fortsetzung überhaupt einordnen kann.
Der Bericht beginnt im Juli 2019 und lässt einen nostalgisch in die Vergangenheit schauen, Angela Merkel war Bundeskanzlerin, Donald Trump US-Präsident, Pandemie war ein Fachwort für Seuchenwissenschaftler, Wladimir Putins North Steam I lieferte billiges Gas in die Republik, Menschen und Begebenheiten werden genannt, die einem heutzutage ganz weit weg erscheinen. Er endet im September 2023, Olaf Scholz ist Bundeskanzler, Trump will nach der Präsidentschaft Bidens erneut gewählt werden, das Wort Pandemie kennt jedes Kind und Wladimir Putin liefert kein Gas mehr, führt aber einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine. Dazwischen liegt die Ratspräsidentschaft von Ursula von der Leyen, die, laut Sonneborn, wohl rechtsfehlerhaft zustande kam, da Frau v. d. Leyen keine Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Europaparlament war. Mit solchen und anderen Informationen über Schiebereien, Korruption und Vetternwirtschaft bedient der Parlamentarier die interessierten Leser. Die Schilderungen sind mit einem hintergründigen Humor geschrieben, nicht umsonst ist der Ex-Mitarbeiter der „heute-show“ Herausgeber eines Satiremagazins.
Gar nicht thematisiert werden in diesem Bericht die Fälle von sexuellem Missbrauch durch andere Kandidaten der Partei. Die Rassismusdebatte um Sonneborn, die zum Austritt des zweiten „Die Partei“-EU-Parlamentariers, Nico Semsrott, führte, wird zwar erwähnt, aber recht kurz behandelt.
Sonneborn macht da weiter, wo er im ersten Buch aufgehört hat und protokolliert über fünf Jahre seine parlamentarischen und außerparlamentarischen Aktivitäten, meist gespiegelt und kommentiert in den Berichten der Presse und/oder des „Netzes“. Obwohl es sich nicht so anhört, Sonneborn ist nicht gegen Europa und sein Parlament, sondern will die Entscheidungsstrukturen dem Bürger und Verbraucher zugänglich machen, nicht den Berufspolitikern und Lobbyisten die Macht überlassen, denn der Abgeordnete will noch einmal antreten für Europa. Es ist auch ein Motivationsbuch für den Gang zur Urne am 9. Juni, egal welche Partei Sie wählen, und im Preis-/Seitenverhältnis bei der gebotenen Unterhaltung sehr günstig.
Torsten Hübler
MARTIN SONNEBORN, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel, Neue Abenteuer im Europaparlament, 432 Seiten, Pb., KiWi-Paperback, ISBN 978-3-462-00600-1, 20,- Euro
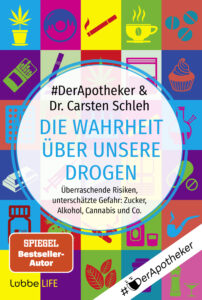
Die Wahrheit über unsere Drogen
So lautet der Haupttitel. Hmmm. Wer will denn diesmal „die Wahrheit“ gepachtet haben?
Kurze Recherche, denn einer der Autoren nennt sich einfach, Achtung, „#DerApotheker“: Er ist studierter Pharmazeut, arbeitet schon lange in einer Apotheke und will, auch über seinen Internet-Blog, aufklären. Zum Beispiel, welche verkauften Mittel wirken, welche nicht. Er will Wissen vermitteln. Sein Ko-Autor Dr. Carsten Schleh ist Toxikologe und nimmt im Buch jede vorgestellte gängige Substanz, ob Alkohol, Heroin, Ecstasy, LSD, Crystal Meth, Pilze, Cannabis, Tilidin, LSD, Benzos, Lachgas, Nikotin und auch Kaffee und Zucker detailliert unter die Lupe – von der Entdeckung an bis hin zur chemischen Formel und wo genau in Hirn und Nervensystem sie ganz genau was macht.
Das klingt trocken nach Lehrbuch oder Lexikon – ist es aber überhaupt nicht, sondern eher fast so spannend wie ein Krimi, Tatsache! Denn aufgelockert wird die große Menge an Informationen durch Kapitelanfänge „aus dem Leben erzählt“, beide führen (fiktiv) kostenlose Beratungen über Drogen durch und aus den Klientengeschichten und Fragen ergeben sich dann die wissenschaftlichen Erläuterungen, inklusive Erkenntnisse über Nebenwirkungen, Folgen für den Körper, Todesfälle weltweit usw.
Aufgrund der wirklich unzähligen Aha-Momente als Leserin kann ich nur ein paar herausgreifen. Es beginnt schon mit Cannabis, ganz aktuell. Kennen Sie den Unterschied zwischen Marihuana und Hasch? Mir war es neu: Während das eine das getrocknete Kraut bezeichnet, ist Haschisch das reine Harz – und zwar, in ganz genau, das Haardrüsensekret der (weiblichen) Pflanze. Das enthält am meisten THC (Tetrahydrocannabiol). Und wie fast jede Droge dockt es an bestimmte Rezeptoren unseres Gehirns/Nervensystems an – das heißt, dort, wo sich sonst körpereigene Nervenbotenstoffe anbinden, um Informationen weiterzugeben und Körperprozesse zu aktivieren. In diesem Fall THC bindet es an unsere Cannabioid-Rezeptoren, zuständig zum Beispiel für Lernen, Gedächtnis, Fortpflanzung, Angst, Immunsystem an.
Na gut, wenn Ihnen das nicht so neu war, hier noch ein Beispiel: Heroin. Der Name erinnert an „heroisch“, nicht wahr? Warum? Kommt gleich … Schon 1897 wurde es von einem Chemiker hergestellt, weil er das Opiat Morphin (auch die Opiumgeschichte ist interessant im Buch) halbsynthetisieren wollte, um einen Ersatz zu schaffen, der die Atemfunktion lungenkranker Patienten (Tuberkulosezeit) verbesserte. In der Poliklinik der Bayerwerke wurde es an Mitarbeitern getestet, mit Erfolg. Viele von ihnen fühlten sich nach der Einnahme von Diacetylmorphin, das über Umwege an einen Rezeptor anbindet, der für Schmerzhemmung und Euphorie bekannt ist, geradewegs „heroisch“ …. Es wurde auch angewendet bei Depressionen, Magenkrebs, Bluthochdruck usw. und niemand ging damals davon aus, dass es süchtig machen könnte. Oder man enthielt es vor? Das erkannte man offiziell erst sieben Jahre später an. Nach vielen, vielen Menschen, die abhängig wurden und der deshalb stattfindenden weltweiten Opiumkonferenz in Genf 1925: Dort trat ein Abkommen in Kraft, das Heroin, Kokain und Cannabis als illegal einstufte und verbot! Außer zu medizinischen Zwecken, ein Beispiel: Im Vietnamkrieg wurde es zur Schmerzbekämpfung eingesetzt, tausende Veteranen wurden süchtig danach …
Oder wussten Sie schon von der „Hausfrauenschokolade?“ Das waren im Grunde Crystal Meth-versetzte Pralinen … 1938 kam von den Berliner Temmler-Werken Methampheminhydrochlorid (damals als Pervitin) auf den Markt, entwickelt zur Stimulation des Kreislaufs, zur Stimmungsaufhellung, um wach zu bleiben. Es regt vor allem die Freisetzung von Noadrenalin und Dopamin an. Im zweiten Weltkrieg bekamen es viele Soldaten, weil man feststellte, dass es Angst und Hunger reduzierte und ewig wachhielt. Die meisten von ihnen wurden abhängig.
Oder: Was geschah mit dem amerikanischen Farmer, der täglich 36 Tassen Kaffee trank? Wieso hatte Goethe Anteil an der Entdeckung des Coffeins? Was haben Veladas der südamerikanischen Indigenen mit Magic Mushrooms zu tun? Wieso macht Zucker so etwas ähnliches wie süchtig, oder stimmt das gar nicht? Und so weiter …
Ich kann Ihnen diesen wissenschaftlichen Drogen-„Krimi“ nur wärmstens empfehlen, liebe LeserInnen.
Anja Wilhelm
#DerApotheker 6 Dr. Carsten Schleh, DIE WAHRHEIT ÜBER UNSERE DROGEN, Überraschende Risiken, unterschätzte Gefahr: Zucker, Alkohol, Cannabis und Co., Lübbe LIFE, 333 S., 14 Euro, ISBN: 978-3-404-06012-2
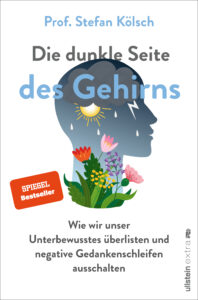
Die dunkle Seite unseres Gehirns
Es wird Frühjahr. Eine Spitzmaus bahnt sich ihren Weg aus ihrer Erdhöhle ans Tageslicht. Hunger! Ah, ein Grashüpfer, ganz nah. Weiter hinten ein viel nährstoffreicherer Käfer, da müsste sie nicht so bald wieder auf Jagd. Aber der Boden erzittert, eine Dino-Herde kündigt sich an. Lieber doch nur den dürren Grashüpfer? Oder wegen des Käfers das Leben riskieren? Wenn sie den doch nicht bekommt, ist der Grashüpfer aber vielleicht auch schon weg. In Millisekunden triff die Maus ihre Entscheidung – natürlich ohne nachzudenken. Ihr Unterbewusstsein schätzt blitzschnell alles ein und sie handelt.
Was sie wählt, verrate ich Ihnen hier aber nicht … lesen Sie selbst.
Am Verblüffendsten in diesem populärwissenschaftlichen Buch von Prof. Stefan Kölsch, einem renommierten deutsch-amerikanisch-norwegischen Psychologen und Neurologen, fand ich diese Erkenntnis: In jeder Sekunde nehmen unsere Sinneszellen Informationen auf, und zwar 1 Milliarde bits, das sind etwa Inhalte von 125 Büchern. 99 Prozent davon filtert unser Gehirn von allein heraus. Übrig bleiben 200 Buchseiten pro Sekunde. Und diese werden fast alle unbewusst verarbeitet. Ins Bewusstsein gelangt nur ein Sätzchen mit 12 Zeichen …
Um diese unbewusst verarbeiteten Informationen geht es vor allem im Buch. Was geschieht dort oben ohne unser Zutun, im Orbitofrontalkortex des Hirns?
An vielen Beispielen erklärt Prof. Kölsch das, was die Neurowissenschaft und Psychologie bis jetzt herausfanden mittels Studien und Hirnscans: Unser Unterbewusstsein ist als eine Art Überlebenssystem entstanden, das schneller als der Verstand, in Millisekunden, Gefahren erkennt, Situationen beurteilt, Risiken abwägt und den Körper unvorstellbar rasch automatisch reagieren lässt. Also: Das Überleben sichert.
Aber wonach bewertet es? In kurz: Besonders in den ersten sieben Lebensjahren eines Menschen wird es geprägt durch Lernen im sozialen Umfeld, durch eigene Erfahrungen (auch Traumata), durch Verhalten der Eltern, der Gruppe. Gutgläubig und unkritisch, ob es nun wahr oder falsch, schlecht oder gut ist. Alles wird gespeichert, ebenso Emotionen. Daraus ergeben sich im späteren Leben Verhaltensweisen, Persönlichkeitsstile. Angststörungen, Depressionen, Habgier, Verlustfrust ebenso wie Optimismus oder eine vertrauende Einstellung zum Dasein. Und sehr, sehr viel mehr … ein Beispiel doch noch: Der Konformitätsdrang. Zu einer Gruppe gehören zu wollen – und das war einst überlebenswichtig und ist es heute noch (ein Kind kann ohne Mutter/Vater nicht überleben zum Beispiel) – ist ebenso im Unterbewusstsein fest verankert. Um nicht ausgestoßen zu werden, muss man sich an die Regeln halten, an Normen. Das kann heute außer einem Stamm auch die Partei sein, die Religionsgemeinschaft, die Nation … Das Unterbewusstsein filtert und verzerrt die Wirklichkeit allerdings immer genau nach dem einst Erlernten, nur das ist wahr. So entstehen Konflikte auf allen Ebenen.
Vieles, was so täglich geschieht, worüber man sich ärgert oder freut, was besorgt oder Furcht hervorruft, sogar wie man streitet und worum oder weshalb man sich gestresst fühlt oder ständig negativ denkt … kann sich der Lesende dank des Buches selbst erschließen als aus dem Unterbewusstsein kommend. Denn die gute Nachricht ist: Ich kann zu erkennen lernen, wann und wie das Unterbewusstsein am Werke ist – und bewusst den Verstand einschalten. Das Unterbewusstsein überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten, so lautet ja auch der Untertitel des Buches. Dazu bietet Prof. Kölsch viele praktische Tipps im letzten Kapitel.
Noch ein toller Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf, auch wenn ich den Bezug zum Buchtitel nicht so ganz herstellen kann, vielleicht geht es ums unbewusste Verteidigen von Positionen: Da streiten sich zwei um nur eine Kokosnuss. Jeder will sie haben. Jeder will den Sieg. Der Kompromiss wäre: Teilen. Aber als einer fragt, wieso der andere denn die Nuss unbedingt möchte, wendet sich das Blatt: Der eine ist nämlich nur scharf auf das Kokosfleisch, der andere auf die Milch! Eine Win-Win-Lösung. Jeder bekommt genau das, was er wollte, und nicht gar nichts oder bloß die Hälfte davon … Prof. Kölsch ist der Meinung, dass dies die Zukunft der Konfliktlösung werden könnte. Müsste.
Global gesehen gäbe es dann wohl keine Kriegsopfer mehr, ja, das wäre doch ein Hoffnungsschimmer …
Anja Wilhelm
Prof. STEFAN KÖLSCH, Die dunkle Seite des Gehirns, Ullstein, Paperback, 384 Seiten, ISBN 9783864931963, 20,99 €
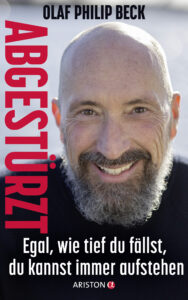
Abgestuerzt von Olaf Philip Beck
Abgestürzt
Besser noch weist der Untertitel des Buches auf seinen Inhalt hin: „Egal, wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen“! Denn das ist es, was in Olaf Philip Becks Geschichte beweiskräftig dargestellt ist. Aufgeschrieben übrigens nicht von ihm selbst, sondern von einem Journalisten, Kai Psotta. Und zwar toll aufgeschrieben, sprachlich lebendig und mitreißend.
Wer ist Olaf Beck? Kurz gesagt: Ein Mathe-Fünfenschreiber aus Wuppertal, der den Bewerbungstest zum Kampfschimmer nicht bestand und dann, nach seiner Lehre als Hotelfachmann, die Karriereleiter aufstieg und ein bekannter Hotelmanager wurde. Er verhalf so einigen Fünf-Sterne-Hotels zu neuer Kundschaft und bestem Ruf. Ein Lösungsfinder, ein Macher. Mal hinter die Kulissen der Hotellerie zu schauen mit ihm war übrigens auch sehr spannend.
Dieser kräftezehrende geliebte Job wurde leider auch zur Kulisse für seinen Absturz in den Sumpf, so nennt er es: Alkoholismus, Pegelsaufen mit Abstürzen, mit Promille Autofahren, Fettleibigkeit, Schulden, Wohnenmüssen in seinem alten Kinderzimmer bei Mutti, Verlottern, Gesundheitsprobleme bereits mit Mitte 30 … Aber wieso?
Schon früh durchlebt er Todesangst in Panikattacken, bei denen er sogar ohnmächtig wird. Überall, wo es eng wird, ob im Gotthardtunnel, in der MRT-Röhre, im Flugzeug oder in Menschengetümmel. Die Angst davor betäubt er mit immer mehr und mehr Alkohol. Auf diesem Weg in die Abhängigkeit bleibt er zwar vorerst gut im Job, aber sein Äußeres verändert sich, er wird, einst rank, superaktiv und sportlich, sehr stark übergewichtig und lässt sich weiter gehen. In die Breite.
Er weiß irgendwann, dass er Alkoholiker ist. Aber der zu beginnende Weg braucht einige Anläufe. Entgiftung, Rückfall, Entgiftung, Rückfall, Angsttherapie usw. Er liest viel über zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und erfährt, dass er sein Gehirn umprogrammieren kann. Dass er einen Tagesrhythmus braucht. Dass er wieder gehen muss, auch wortwörtlich. Für einen 165 kg-Mann eine riesige Überwindung. Er beginnt mit ein paar Schritten im Park – und immer weiter geht er … und bleibt stabil trocken. Arbeitet sich aus seinen hohen Schulden heraus (auch, indem er bei „Wer wird Millionär“ eine gute Summe gewinnt, auch diese Episode ist sehr interessant zu lesen).
Er könnte sofort wieder als Hotelmanager arbeiten … aber er will nicht mehr, fühlt sich depressiv. Er sucht „seine Bestimmung“.
Inzwischen hat er sie gefunden. Er berät Menschen, die sich oder/und etwas in ihrem Leben verändern wollen: „Für mehr Erfolg, Motivation und Lebensqualität“, steht auf seiner Coaching-Webseite. Sein Grundsatz: Die Lösung liegt ausschließlich in einem selbst. Und er hilft dabei, zu ihr zu finden. Die Menschen „… wenden sich an mich, weil ich es aus mir heraus geschafft habe. Ich habe gezeigt, das es geht. Das Leben ist mein Diplom.“
Ein spannendes und sehr, sehr motivierendes Buch, finde ich.
Anja Wilhelm
OLAF PHILIP BECK, Abgestürzt, Ariston Verlag, Hardcover, 240 Seiten, ISBN: 978-3-424-20287-8, 22Euro
Daniel Schreiber trauert um seinen Vater
Kein Tod in Venedig
Daniel Schreiber, Autor von „Allein“, „Zuhause“, „Nüchtern“, hat seinem neuesten Essay drei Worte mehr im Titel gegönnt. Schreiber befindet sich in Venedig und neben dem Besuch der todgeweihten Stadt bearbeitet er die Trauer um den Tod seines Vaters.
Sofort kommt dem versierten Leser oder der Leserin Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ in den Sinn, in der schon der angeblich morbide Charme der damals und heute von Touristen überlaufenen Stadt beschrieben wird. Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt, Daniel Schreiber, scheinbar Stipendiat, ist Gast im Deutschen Studienzentrum in Venedig, beschreibt seinen Tagesverlauf, ein Frühstück in einer kleinen Bäckerei, Besuch eines Museums mit Betrachtung eines Kunstwerkes, Besuch der Friedhofsinsel, Besuch eines Restaurants, Fahrt über die Kanäle, auch Yogaübungen im Zentrum mit anderen Stipendiatinnen werde beschrieben. Diese Beschreibungen, die einen gerüttet Anteil des Textes ausmachen, sind sehr ausführlich und detailreich. Diese umständliche und redundante Erzählweise, die man von den vorhergehenden Essays von Schreiber kennt, kann ermüdend wirken. Auch die ständigen Verweise auf Veröffentlichung, meist US-amerikanischer Autorinnen, zu der aktuell anstehenden Handlung oder des gerade gefassten Gedankens wirkt nicht sehr erhellend.
Die zweite Ebene bilden Trauer und Schmerz, die den Protagonisten über den Tod seines Vaters befallen. Man erfährt einiges über das Leben des Vaters, der Eltern, aber bruchstückhaft und vage. Der Tod des Vaters ist wohl schon vor längerer Zeit erfolgt, und es stellt sich der Leserin, dem Leser die Frage, warum trauert der namenlosen Ich-Erzähler gerade jetzt?
Dem schmalen Band werden 53 Anmerkungen auf vier Seiten und weitere vier Seiten Literaturverzeichnis angehängt sowie zwei Seiten der Danksagung.
Als Zeitverlust hat der Rezensent die Beschäftigung mit „Die Zeit der Verluste“ nicht empfunden, aber im Gegensatz zu „Nüchtern“ desselben Autors wirkt das Essay wie ein pflichtschuldiger Bericht an eine stipendienausreichende Institution.
Torsten Hübler
DANIEL SCHREIBER, Die Zeit der Verluste, 144 Seiten, geb., Hanser Berlin, ISBN 978-3-446-27800-4, 22,- Euro
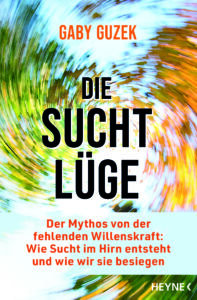
Die Suchtluege von Gaby Guzek
Die Suchtlüge
Ja, so drastisch lautet der Titel des zweiten Buches von Gaby Guzek (nach „Alkohol adé“).
Fast provokant: Wer lügt? Und womit?
Nehmen wir das letzte Kapitel zuvor, um Ihre Neugier zu stillen, liebe LeserInnen. Zitat Seite 205: „Ihr Suchtberater lügt Sie nicht an. Genauso wenig wie Ihr Hausarzt oder Ihr Therapeut. Trotzdem ist die heutige Suchttherapie eine kollektive Lüge. Sie gibt vor, die Gründe für Sucht im Wesentlichen zu kennen und auch behandeln zu können. Genau das stimmt aber nicht.“ Und: Auch schweigen und weitermachen wie immer kann lügen sein, sagt die Autorin an anderer Stelle …
Aha. Und was ist nun die kollektive Lüge?
Wenn ich es richtig verstanden habe, sei Sucht weder eine Willensschwäche (das wissen wir) noch eine psychische Erkrankung (das ist neu), als die sie seit Jahrzehnten behandelt wird. Sondern, salopp zusammengefasst, ein „erklärbarer Vorgang im Gehirn“. Ein Ungleichgewicht in der Hirnchemie.
Als sauber recherchierende Wissenschaftsjournalistin und selbst Betroffene kritisiert Gaby Guzek die heutige Suchttherapie auf ihre Weise. Denn es gibt immer neue Forschungsergebnisse, die ihre These bestätigen. Sie finden allerdings in der heutigen Suchtbehandlung noch immer keine Anwendung.
Damit wir das nachvollziehen können, erklärt sie uns genau, was im Gehirn passiert, wie Nervenbotenstoffe arbeiten (z.B. GABA, Serotonin, Dopamin, Glutamat u.a.), wie Drogen die entsprechenden Andockstellen besetzen, welche Auswirkungen das hat, wie man süchtig wird und warum. Es ist, wie das gesamte Buch, erfrischend und endlich mal verständlich für den Laien erklärt. Nachvollziehbar. Wir erfahren auch, dass bestimmte Nährstoffe, Vitamine und Mineralien unabdingbar sind, damit die Nervenbotenstoffe vom Körper überhaupt produziert werden können. Ebenso superwichtig ist dafür eine gesunde Darmflora (Mikrobiom).
Das klingt für suchtgeplagte und psychotherapieerfahrene Betroffene erstmal irgendwie zu … einfach, oder? Nähr- und Botenstoffmangel als biochemische Ursachen der Sucht? Aber selbst mit solch kritischem Blick habe ich mich der zwingenden Logik im Buch ergeben, Tatsache.
Weshalb ändert sich also nichts in der Suchtbehandlung?
Weil Medizin ein verknöchertes System sei, meint Gaby Guzek. Als ein Beispiel bringt sie die zwei Forscher, die herausfanden, dass die Ursache von Magengeschwüren ein Bakterium ist. Bis dahin wurde diese Erkrankung psychotherapeutisch zu behandeln versucht, viele Patienten starben. Die Forscher wurden ausgelacht. Aber 20 Jahre später bekamen sie den Nobelpreis für ihre Erkenntnis!
Und noch: Weil die heutige Suchttherapie ein Milliardengeschäft sei, die Suchtkliniken verdienen sehr gut an dem, wie es jetzt ist … Aber dem gegenüber steht, dass nur jeder zehnte Patient langfristig trocken lebt nach einer Langzeittherapie. Wäre das nicht des Umdenkens wert? Was würde passieren, wenn einem Chirurgen nur jede zehnte Operation gelänge?
Nach Gaby Guzeks Meinung müsste eine Suchtbehandlung damit beginnen, dass zuerst biochemische Mangelzustände mittels Labor festgestellt werden. Nur ein Beispiel, so wie ich es verstanden habe: Ein Mangel an GABA, das ist ein Entspannungsbotenstoff, kann zu Angsterkrankungen führen, die den Betroffenen in der Selbstmedikation mit Alkohol (dockt an GABA-Rezeptoren an) für ein paar Stunden davon erlösen, den möglichen folgenden Weg in die Sucht kennen wir. Was aber wäre, wenn der Patient den Mangel ausgleichen könnte mit einer GABA-Gabe oder per Nährstoffen? Würde ihm die Abstinenz dann nicht viel leichter fallen vielleicht?
Die Autorin lässt die LeserInnen aber nicht allein mit diesen Erkenntnissen. Sie wendet sich vor allem an Betroffene, die aus der Sucht aussteigen wollen (es geht um alle Süchte, von Alkohol, Drogen, Nikotin, Sexsucht bis Internetsucht und Gaming) und nimmt sie sozusagen an die Hand mit vielen praktischen Hinweisen und erprobten Ratschlägen in den beiden Kapiteln „Erfolgreich aus der Sucht“ und „Strategien für den abstinenten Alltag“. Einiges ist dem trockenen Alkoholiker bereits vertraut, anderes mag manchem neu sein. Sie geht natürlich auch auf wichtige Nährstoffe ein. Lassen Sie sich überraschen.
Eines betont und erklärt sie immer wieder: Nur aufzuhören und ansonsten alles weiterzumachen wie immer funktioniert nicht, um zufrieden abstinent zu werden. Abstinenz bedeutet Arbeit an sich, um letztlich frei zu sein, un-abhängig.
Ich kann dieses frische, ermutigende und rebellische Buch nur empfehlen. Mir hat es den Horizont erweitert. Die einzige Konstante ist die Veränderung, heißt es doch. Weshalb sollte das für die Suchtbehandlung nicht gelten? Was wäre, wenn … es so wäre, wie Gaby Guzek beschreibt?
Anja Wilhelm
GABY GUZEK, Die Suchtlüge – Der Mythos von der fehlenden Willenskraft: Wie Sucht im Hirn entsteht und wie wir sie besiegen, Heyne Verlag, TB, 224 Seiten, ISBN: 978-3-453-60670-8, 13 Euro
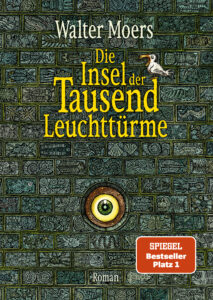
Neuer Roman von Walter Moers
Von Hummdudeln und dem Kraakenfieken
Der Zeichner des „Kleinen Arschlochs“ und der Erfinder des „Käpt´n Blaubär“ hat sich in mehreren Büchern, beginnend 1999 mit „Die dreizehneinhalb Leben des Käpt’n Blaubär“, einen eigenen Kontinent, Zamonien, erschaffen. Held seiner Geschichten ist Hildegunst von Mythenmetz, in Zamonien ein höchst angesehener Autor und Drache. Moers legt mit „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ eine gewichtige Fortsetzung, über 1,2 Kilogramm schwer und mit 665 Seiten Umfang, vor. Dieses Mal ist es ein monologischer Briefroman, da die Antworten des Brieffreundes wetterbedingt nicht auf die Insel Eydernorn, gelangen, wo sich der Großschriftsteller zur Kur aufhält.
Auf dem abgelegenen Eiland konnten sich vermehrungsfreudige Hummdudeln und flugunfähige Strandlöper und anderes entwickeln. Unterhaltung finden die Insulaner beim Krakenfieken-Sport. Von den titelgebenden Leuchttürmen gibt es gar keine tausend, sondern lediglich 111, die alle individuell gestaltet sind und jeder von einem Genie eigener Art bewohnt ist. Das Wetter spielt im Ablauf der Handlung eine wichtige Rolle. Hildegunst wird vom Kurgast, der mit überteuertem und schlechtem „Dünenwein“ seine Erfahrung machen muss und dessen Heilbehandlung widersinnige Ergebnisse bringt, eher zufällig zu einem Entdecker und Abenteurer, der die Geheimnisse der Insel entdeckt und einem furiosen Finale entgegensieht. Die Leserin, der Leser folgt gebannt der detailverliebten Schilderung der Erlebnisse in 19 Briefen. Hier greift Moers auf das Format des Briefromans, der nicht nur im 18. und 19. Jahrhundert gepflegt wurde von Goethe (Werther) bis Bram Stoker (Dracula), zurück. Den Briefen sind auch viele Illustrationen beigefügt, die das märchenhafte Leben auf Eydernorn charakterisieren sollen.
Dieses Feuerwerk von phantastischen Einfällen und kreativen, teils absurden Ideen ist etwas für lesende Menschen, die sich Humor und Neugier erhalten haben und ziert auch jeden Gabentisch.
Torsten Hübler
Nein Danke, keinen Alkohol für mich!
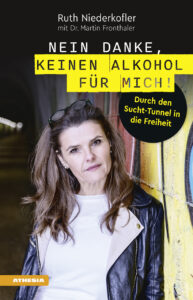 Zwar reiht sich dieses Buch ein in die inzwischen große Anzahl von ermutigenden Erfahrungsberichten trocken Gewordener, aber es ist meiner Ansicht nach besonders: Es könnte fast eine Suchtfibel sein. Die Autorin Ruth Niederkofler aus Südtirol, aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Ahrntal, beschreibt nicht einfach nur, wie sie süchtig wurde und viel später dann abstinent, sondern hat sich ihren ehemaligen Psychotherapeuten mit ins Boot geholt und auch Clara kommt zu Wort, symbolhaft für Angehörige. Trialogisch, so nennt sie das, ist das Buch aufgebaut.
Zwar reiht sich dieses Buch ein in die inzwischen große Anzahl von ermutigenden Erfahrungsberichten trocken Gewordener, aber es ist meiner Ansicht nach besonders: Es könnte fast eine Suchtfibel sein. Die Autorin Ruth Niederkofler aus Südtirol, aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Ahrntal, beschreibt nicht einfach nur, wie sie süchtig wurde und viel später dann abstinent, sondern hat sich ihren ehemaligen Psychotherapeuten mit ins Boot geholt und auch Clara kommt zu Wort, symbolhaft für Angehörige. Trialogisch, so nennt sie das, ist das Buch aufgebaut.
Fast sachlich-neutral beschreibt sie ihre Sucht-Lebensabschnitte, anschließend reflektiert sie sie aus heutiger Sicht. Zu den jeweiligen Phasen ihrer Suchtentwicklung erklärt Dr. Martin, was Sucht ist, wie sie entsteht, wie man sie an sich erkennt, am Ende des Buches dann zum Beispiel, wie Entgiftung und Therapie ablaufen. Clara erklärt Angehörigen und Freunden Betroffener, weshalb alles Reden oder Vorwürfe nichts nützen, sondern was wirklich hilft, ihnen selbst und dem Trinkenden. Die beiden Koautoren beantworten viele, viele Fragen, die Betroffene und Angehörige haben oder haben könnten. Sehr informativ. Ohne Vorwürfe, erhobenen Zeigefinger, sondern immer wohlwollend, fast herzerwärmend, an die Hand nehmend. So, wie es Menschen in Not, die sich eh schon genug schämen, auch benötigen. Den Grundtenor empfand ich als tröstlich und hilfreich.
Kurz zu Ruths eigener Geschichte: Geboren nicht als Wunschkind, sondern vom Vater als „übriger Fresser“ bezeichnet und grundsätzlich kaum wahrgenommen, wächst sie schüchtern, introvertiert und ohne Selbstwert auf. Eine Birne in Schnaps eingelegt, damit beginnt ihre Trinkkarriere. Alkohol macht sie plötzlich mutig, fröhlich, selbstbewusst. Partys, Vergewaltigungen, Ehe mit einem, der sich später als Schläger entpuppt. Vermeintliche Unfruchtbarkeit. Alle Probleme und negativen Gefühle betäubt sie mit Alkohol. Nach und nach wird daraus eine Abhängigkeit. Trinkpausen hat sie nur, als sie dann wider Erwarten doch zwei geliebte Kinder bekommt. Eine Eileiterschwangerschaft, der Eileiter reißt, bringt ihr fast den Tod. Bei einer ungewollten vierten Schwangerschaft ertränkt sie sich in Schnaps. Aber das Kind bleibt, kommt schwerstbehindert als Frühchen zur Welt, würde sein Leben nur mithilfe von Maschinen dahinvegetieren. Sie entscheidet sich, sie abstellen zu lassen. Das verfolgt sie ihr Leben lang, das Schuldgefühl. Dennoch trinkt sie weiter. Immer bis zum Absturz zum Schluss, ihr Ziel ist immer der große Rausch. Bis sie es und sich selbst nicht mehr ertragen kann, sie will sich umbringen. Landet in der Psychiatrie. Später erkennt sie endlich, dass sie abhängig ist. Und fasst den Entschluss, sich helfen zu lassen. Seit der Langzeittherapie ist sie trocken. Von Beruf Pflegehelferin, beginnt sie wieder zu arbeiten, macht eine Ausbildung zur Sozialbetreuerin und Ex-in-Genesungsbegleiterin. Sie hilft inzwischen Betroffenen, wie sie selbst eine war.
Und diesem Zweck dient auch ihr Buch, wie sie im Vorwort beschreibt: „Durch meine Geschichte und meine Erfahrungen möchte ich Betroffenen Hoffnung schenken … Mut machen. Mut, den steinigen und oft harten Weg aus der Sucht zu wählen, zurück in ein Leben in Freiheit.“
Ich denke, ja, genau dies tut dieses Buch.
Anja Wilhelm
RUTH NIEDERKOFLER, Mit Dr. Martin Fronthaler, Nein Danke, keinen Alkohol für mich! Durch den Suchttunnel in die Freiheit, ATHESIA Verlag, Paperback, 272 Seiten, 24,- Euro, ISBN: 978-88-6839-690-9
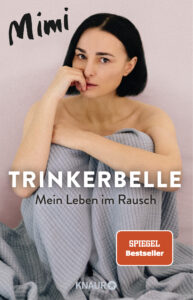 Trinkerbelle
Trinkerbelle
Das Buch hat mich umgehauen, liebe LeserInnen.
Sogar im wahrsten Sinne des Wortes: Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen, weil es so wunderbar geschrieben ist – so dass ich mitgelebt, mitgetrauert, mich mitgeschämt und Schuldgefühle mitgetragen habe … und es mir irgendwann gar nicht mehr gutging. Im Magen, im Kopf, in der Seele. Lassen Sie sich also lieber Zeit, legen Sie Pausen ein. Denn das Buch ähnelt einem Spiegel, in dem Sie Dinge aus Ihrer Trinkerzeit sehen, erinnern können, gar müssen, die Sie so detailgenau doch vielleicht lieber vergessen hatten, tief verscharrt. Vielleicht. Mir ging es so. Und nun kam es mit dem Lesen herausgeflossen … Aber Mimi Fiedlers Buch endet hoffnungsfroh, ermutigend, mit Happyend. Und lächeln, gar grinsen darf man trotz aller prallvollen Dramatik auch ab und zu. Das sei dazugesagt.
Worum geht es? Es beginnt, untypisch für ein Alkoholiker-Erfahrungsbuch, mit Historie. Der dalmatinischen, denn Mimi entstammt einer großen Familie auf einem kleinen Dorf in Kroatien und nimmt uns mit ins Früher. Kriege, Auswanderungen, dazu Slibowitz – damit wir den seelischen Schmerz, der wie ein roter Faden von Generation zu Generation weitergesponnen wurde, wie sie es nennt, verstehen. Denn der ist es, der auf ihr lastet, ohne dass sie das damals so weiß. Auch als Kind aufgestaute Schuldgefühle und der sexuelle Missbrauch sind tief ins Unbewusste gefallen und erzeugen von dort aus stetigem inneren Druck. Mit 14 entdeckt sie, dass Alkohol ihr Wunderheiler ist, er macht sie leicht, frei, schafft ihr eine sorglose eigene Welt. Der heimliche und später auch öffentliche Rausch wird fortan ihr Begleiter.
Später dann, aufgewachsen in einem hessischen Dorf, ihre Eltern waren Gastarbeiter in Deutschland, begann sie nach dem Abitur ein Literaturstudium, wurde aber für den Film entdeckt. Ihr Traum war das nicht und wurde es nie. Die ehemalige „Nachtschwester“ und „Tatort“-Kollegin war erfolgreich, aber was sie am meisten im Job hielt, war, dass sie ungestört und allein in den Drehorthotels trinken konnte. Saufen. Es musste immer enden im Rausch. Manchmal im Blackout. Das körperliche und seelische Elend, das dies mit sich brachte, kennen Betroffene sehr genau. Auch Peinlichkeiten aller Art (bei ihr zum Beispiel: Sie musste bei reichlich Wein so oft zur Toilette, dass sie sich manches Mal einpullerte und ihre Höschen einfach auszog und liegenließ. Oder: Ein hochedles Date-Essen endete mit Verschmutzung des teuren Bades des Gastgebers – hier übrigens lallt sie, dass sie Tinkerbelle sei, eine Trickfilmfee, der Herr missversteht das und lacht: Ja, Trinkerbelle, das passt zu dir).
Mimi erzählt von Partnerschaften, die zerbrechen, von der Geburt ihrer Tochter, bei der sie selbst fast gestorben wäre, ihrer außerkörperlichen Erfahrung dabei, vom Kampf, ihre Tochter bei sich behalten zu dürfen, von Armut, denn sie muss wieder zu ihren Eltern in ihr Kinderzimmer ziehen, davon, wie die Kleine ihre Mutter auf dem Küchenboden auffand und weinend die Nachbarn um Hilfe ruft … Und von ihren Kämpfen ums Aufhören – acht Jahre hat sie gebraucht. Eine Therapie half, die AA-Gruppenbesuche, aber nichts davon auf Dauer. Auf einer panikattackenreichen Reise aber geschieht dann mitten in New York das Wunder, an das sie nie aufgehört hatte zu glauben: IHR Klick. Sie hört IHRE höhere Macht: „Leg Deine Waffen nieder. Du brauchst sie nicht mehr. Es ist vorbei.“ Seitdem ist sie abstinent …
Das war jetzt nur ein winziger Einblick in ein für mich großartiges Buch. Und wenn so manch skeptische Kritiker behaupten, dass Mimi Fiedler damit nur wie andere buchschreibende Prominente ihren weiteren Weg pushen will, glaube ich das nicht. Sie hat es nicht nötig, denn ihren Schauspiel-Beruf hat sie aufgegeben. Und schon gar nicht nötig hat sie es, derart tief in ihr Innerstes blicken zu lassen. Ich gehe davon aus, dass es genau so gemeint ist, wie sie am Ende schreibt: „Ich wünsche Dir, dass auch du dich niemals aufgibst, und hoffe, du konntest in und zwischen meinen Zeilen etwas für dich finden. Einen Ansatz, einen Anstoß, eine Erkenntnis vielleicht …“
Ja! Danke, Mimi.
Anja Wilhelm
Mimi: TRINKERBELLE, Mein Leben im Rausch, Verlag Knaur, TB, 256 Seiten, 18 Euro, ISBN: 978-3-426-79148-6
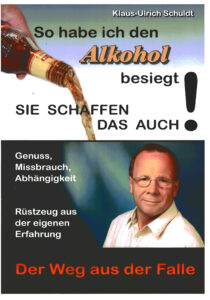 … und Sie schaffen das auch!
… und Sie schaffen das auch!
Autor Klaus-Ulrich Schuldt berichtet in seinem schmalen Büchlein „So habe ich den Alkohol besiegt“ nicht nur von sich selbst und seinem Weg und seinen Erfahrungen. Das ganz Besondere an seinen Zeilen ist, und es hat mich wirklich begeistert: Er nimmt den betroffenen Lesenden mitfühlend und wohlwollend an die Hand. Es ist wortwörtlich ein Handbuch. Und zwar für diejenigen Menschen, die ihren Alkoholmissbrauch einsehen und trocken leben wollen, aber noch ganz, ganz am Anfang stehen. Dort, wo man noch nicht weiß, ob und wie das gehen soll, sich verzweifelt müht, weniger zu trinken oder gar nicht mehr.
Man braucht auf jeden Fall Zettel und Stift für die Lektüre. Klaus-Ulrich beginnt mit einer Negativ-Positiv-Liste, mit einer Bestandsaufnahme: „Schildern Sie in drei bis vier Sätzen Ihren jetzigen Zustand. Es macht nichts, wenn die Hand zittert. Wenn es nicht schön aussieht, … zerreißen sie es nicht. Haben Sie es geschrieben?“ Und so ähnlich führt er den Lesenden weiter. Es geht um grundehrlich zu beantwortende Fragen wie: Heimliches Trinken? Wie reagieren Sie bei Anspielungen auf Ihren Alkoholkonsum? Filmrisse?
Und immer, immer wieder spricht er den Lesenden auch direkt an.
Das Büchlein ermutigt zum Entschluss, aufzuhören. Zehn Schritte geben Betroffenen handfeste Wegesstruktur. Der Haupt-Rat am Ende ist: Suchtberatung (möglichst mit einem Partner oder Freund), Therapie, Gruppe.
Leider ist das Büchlein im Selbstverlag: „So habe ich den Alkohol besiegt – und Sie schaffen das auch!“ vorerst vergriffen, aber der Autor bietet es auch als Online-Version an: https://goo.gl/b1zZsQ.
Anja Wilhelm
Kostenfaktor Mann: Bezahlen tun wir alle
Durch eine Empfehlung wurde der Rezensent auf den schon 2022 erschienenen Titel aufmerksam. Der Autor,
Boris von Heesen, studierter Wirtschaftswissenschaftler und heute Vorstand eines Jugendhilfeträgers, beschreibt die ökonomischen Folgen einer männlich geprägten Umwelt.
Um die Vergleichbarkeit der beschriebenen vielschichtigen Probleme darzustellen, behilft sich der Autor mit
der Anwendung eines in der Ökonomie gängigen Verfahrens, er nimmt als universelle Maßeinheit zur Beschreibung der Umstände Geld, also Euro und Cent, so kann er Kapitel für Kapitel, Problem für Problem
die Kosten des männlichen Verhaltens oder Unterlassens quantifizieren.
Die Datenbasis liefern ihm frei zugängliche Quellen wie Statistiken von Destatis, Versicherungen und anderen, auch veröffentlichte Berechnungen anderer Wissenschaftler sind Teil seiner Berechnungen.
Dies wird in den umfangreichen 370 Fußnoten am Ende des 300-Seiten-Werkes dokumentiert, dem zusätzlich ein Register vorangestellt ist.
Im ersten Teil befasst sich von Heesen mit den messbaren Kosten. Er führt die Kosten für Gefängnisaufenthalte (93,9 Prozent der Gefangenen sind Männer, durchschnittliche Kosten: 130,- € pro Hafttag, insgesamt 3 Mrd. Euro beträgt der männliche Anteil) detailliert auf, angereichert mit weiteren Zahlen und inhaltlichen Erklärungen. Weitere messbare Kosten sind für ihn unter anderem Gewalt gegen Frauen, Sucht und Kriminalität. Wobei die Sucht mit 43,7 Mrd. Euro Kosten bei einer vom Autor berechneten Gesamtschadenssumme von 63,5 Mrd. Euro den größten Posten ausmacht. Die Zahlen sind zu hinterfragen, da er z.B. beim Glücksspiel von ca. 400.000 pathologisch oder problematisch spielenden Menschen ausgeht. Wie hier auf Seite 22 dargestellt, soll es aber 1,4 Millionen Menschen mit pathologischem und weitere drei Millionen mit riskantem Spielverhalten geben.
Im zweiten Teil geht es um die nicht messbaren Kosten, dargestellt werden verschiedene Faktoren wie geringere Lebenserwartung, Suizide (75,7% der Selbstmorde werden von Männern begangen), Rechtsradikalismus usw., deren Auswahl und Gewichtung nicht transparent sind, eher als Illustration „toxischen männlichen Verhaltens“ im „Patriarchat“ dienen.
In Teil 3 wird der Weg aus der Krise gesucht. Die Lösungsmöglichkeiten für die in Teil 1 dargestellten und quantifizierten Probleme klingen nicht realisierbar und berücksichtigen nicht den langfristig kulturell prägenden Einfluss der Wertesysteme, in denen die Menschen aufwachsen.
Die Vorschläge, z.B. bessere Bildung, die Überwindung von Stereotypen, mediales Bild vom „Mann“ usw. versäumen es, einen globalen Blickwinkel einzunehmen und fokussieren auf deutsche Befindlichkeiten, die schon in Europa anders gelagert sein können.
Dieses flüssig geschriebene teils Sachbuch, teils politische Statement kann auf jeden Fall die Diskussion bei der Frage, wie wir künftig leben wollen, bereichern. Ich sehe es als einen weiteren Ansatz, unsere Gesellschaft und die Notwendigkeit zu deren Weiterentwicklung besser zu erklären.
Torsten Hübler
von Heesen, Boris: Was Männer kosten: Der hohe Preis des Patriarchats, 304 S., Softcover, Heyne, ISBN
978-3-453-60624-1, 18,- Euro
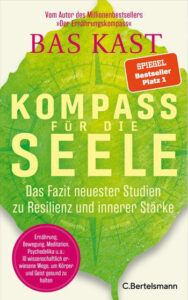 Ein Kompass für Ihren Seelenfrieden?
Ein Kompass für Ihren Seelenfrieden?
Am besten ist bei mir nach der Lektüre hängengeblieben, was für mich als suchtkranken Menschen aber überhaupt nicht in Frage kommen kann: Auf einen Trip zu gehen, mit einem Begleiter und mit MDMA (Ecstasy), LSD oder Pilzen (Psilocybin) … und zwar gegen meine Angststörung. Es ist sooo verlockend, wie der Autor seine eigenen Erfahrungen vom Auflösen des konditionierten Verstandes, damit auch der Angst, und langwirkenden Veränderungen des Bewusstseins spricht. Und er erläutert die neuesten Studien dazu …
Wie in seinem Ernährungskompass-Bestseller hat er auch für dieses Buch unzählige Recherchen geführt, neueste Studien wirklich aus aller Welt eingebunden, die wahrscheinlich keinem von uns je über den Weg gelaufen wären: ein toller Service für Lesende. Und er hat alles tatsächlich selbst auch für sich ausprobiert! Kurzum: Es geht darum, wie wir unsere Psyche, unsere Seele stärken können. Gerade in der heutigen Zeit, in der psychische Erkrankungen stark zunehmen, vor allem Depression und Angsterkrankungen.
Auf die Idee brachte ihn eine Lebenssituation, in der jeder andere sagen würde: Ey, freu dich doch einfach, dir geht es super, du bist Bestseller-Millionär, das war doch immer dein Traum! Aber Bas Kast schreibt: „Inmitten des äußerlichen Erfolges fühlte ich mich zunehmend niedergeschlagen … war doch nicht glücklich, sondern fühlte mich leer.“ Dieses Rätsel wollte er nun ergründen.
Und das hat er geschafft, auch für sich selbst. Er bietet dem Lesenden nun eine Fülle von „Werkzeugen“ an, seelische Tiefs zu überwinden oder ihnen vorzubeugen. Er suchte dabei auch bei asiatischen Weisheitslehrern, den griechischen Stoikern wie Seneca und natürlich in der heutigen Wissenschaft. Er beschreibt mit genauesten Erklärungen, was in einzelnen Gehirn-Arealen vor sich geht (sogar mit Abbildungen), weshalb also genau dies oder jenes seine Wirkungen zeigt:
Zum Beispiel geht es um Ernährung für die Seele, was Bewegung im Gehirn bewirkt, um Aufenthalte in der Natur (Waldbaden u.a.), Musik, soziale Bindung, Achtsamkeit, Meditieren, Atmen und so weiter. Klingt wie „alles schon mal gehört“, oder? Nun, aber vielleicht nicht so, denn das, was mich am Buch besonders fasziniert, ist immer die wissenschaftliche Erläuterung dahinter. WARUM es funktioniert …
Interessant eben auch das lange Kapitel zu den neuesten Erforschungen und klinischen Studien zu Psychedelika (halluzinogen wirksame psychotrope Substanzen, erklärt Wikipedia dazu), wie oben schon beschrieben. Natürlich beschreibt er auch die Risiken und Nebenwirkungen. Nur sollten wir als abhängigkeitserkrankte Menschen vorsichtshalber sowieso die Finger davon lassen.
Auf jeden Fall kann dieser flüssig und frisch geschriebene Ratgeber ein Gewinn für Sie sein, glaube ich. Ich habe mir auch einige Dinge für mich entnehmen können, die ich jetzt tatsächlich praktiziere.
Ich gehe nämlich jetzt zum Beispiel Waldbaden, tschüssi 😊.
Anja Wilhelm
BAS KAST: Kompass für die Seele, Hardcover, 256 Seiten, Bertelsmann Verlag, ISBN: 978-3-570-10461-3, 24 Euro
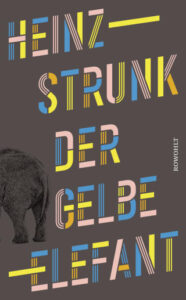 „Der gelbe Elefant“ von Heinz Strunk – 30 Miniaturen
„Der gelbe Elefant“ von Heinz Strunk – 30 Miniaturen
Heinz Strunk geht steil
Der Sommer ist da, der neue Strunk erscheint. Dieses Mal bietet der 61-Jährige den Lesenden nicht einen Roman, sondern ein Potpourri aus 30 sehr kurzen und etwas längeren Texten an.
Wie in seinem vorhergehenden Roman „Ein Sommer in Niendorf“ beobachtet der Autor seine Mitmenschen scharf und berichtet darüber mit einem Sprachwitz, der das Markenzeichen seines literarischen Wirkens ist. Es geht bei ihm um Menschen wie Dich und mich. Da wird die Schilderung eines 90. Geburtstages oder ein Besuch „beim Griechen“ mit einem befreundeten Paar mit spitzer Feder seziert, bis nur noch Jammer bleibt, der aber mit einer kräftigen Prise untergründigem Humor gewürzt ist. Eine Fahrt von Düsseldorf über Mettmann nach Bochum erweist sich als überraschendes Abenteuer. Eine Dystopie über unser aller Zukunft halten die vier Seiten „Frivillig över klippan“ bereit. „Nachrichten von Carola“ zeichnen anhand eines SMS-Monologs den alkoholischen Verfall einer jungen Frau nach, recht humorlos. Der auch als Humorist und Titanic-Autor bekannte Strunk legt in diesem Buch seinen Schwerpunkt auf Verfall, Alter und Tod, denen er durchaus für die Leserin und den Leser etwas Komisches abgewinnen kann. „Der Goldene Handschuh“, ein Roman über einen Hamburger Frauenmörder, lässt grüßen. Bemerkenswert ist auch, wie er in den meisten Geschichten die wichtige Rolle des Alkohols in einer meist bürgerlichen Umgebung darstellt, und das nicht unbedingt im Positiven.
Die gut 200 Seiten sollte man nicht flüssig durchlesen, da die berührten Fragestellungen sich auch an die Lesenden richten. Die schwarzhumorige Wortakrobatik Strunks dämpft dann aber die Betroffenheit sehr.
Torsten Hübler
HEINZ STRUNK, Der gelbe Elefant, 208 Seiten, geb., Rowohlt, Hamburg, ISBN 978-3-498-00350-0, 22,00 Euro
„Rausch. Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann“,
Lesen, bis der Notarzt kommt
Der Rostocker Notfallmediziner, Anästhesist und ärztlicher Leiter des Fusion Festivals mit 80.000 Besuchern gibt sein Wissen als Experte für den Freizeitdrogenkonsum an Interessierte weiter.
Das Hauptanliegen des Autors ist die Neujustierung des deutschen Rauschmittelwesens. Dazu holt er weit aus und stellt die Fakten dar.
Begonnen wird mit der detailliert recherchierten Geschichte des Rauschmittels, er beginnt mit der vergorenen Frucht, die Tiere verzehren, erzählt von Hanffaserfunden, uralten Rauschpilzen, Opium der Phönizier, um dann zum Bierbrauen im alten Ägypten zu gelangen, auch der Weinanbau kommt nicht zu kurz. Rücker geht dann über das alkoholisch berauschte Mittelalter zum Zeitalter der Entdeckung der Welt, damit kam auch der internationale Drogenhandel in Schwung, Koka aus Amerika, Opium aus Asien, Tabak, Kaffee usw. Die industrielle Revolution revolutionierte auch die Alkoholherstellung und die Erschaffung neuer Drogen wie Heroin.
Weiter geht es mit dem medizinischen und chemischen Teil des Rausches. Es werden der Aufbau des Hirns erklärt und die Funktion der verschiedenen Teile. Die Chemie der einzelnen Substanzen und ihre Wirkung auf Nerven und Hirn. Angereichert ist das Ganze mit aussagekräftigen Grafiken.
Dem Alkohol, dem gefährlichsten Rauschmittel, ist ein umfangreiches eigenes Kapitel gewidmet, Kosten und Kriminalität werden ebenso thematisiert wie die Untersuchungen von David Nutt. Wenn man sich schon knapp 190 Seiten mit Rauschmitteln befasst hat, dann ist die logische Folge die Sucht, die im vorletzten Kapitel behandelt wird.
Im letzten Kapitel kommt der Verfasser zu seinem Anliegen, die überragende Gefährlichkeit von Alkohol im Vergleich mit anderen Rauschmitteln wie z.B, Cannabis herauszustellen. Als Konsequenz aus den vorausgehenden Ausführungen kristallisiert er einen Zehn-Punkte-Aktionsplan zur Verbesserung des Umgangs mit Alkohol. Es sind die auch in der TrokkenPresse und von anderen lange geforderten, leicht umzusetzenden und preiswerten Korrekturen: Null Promille im Straßenverkehr, Einschränkung der Verfügbarkeit, Preiserhöhung, Erhöhung des Abgabealters auf 18 Jahre usw. Neu und interessant ist die Forderung nach einer Angabe der Grammzahl von Alkohol auf jeder Flasche, damit man seinen individuellen Promillewert leichter berechnen kann. Die Forderung der Besetzung des Amtes der Drogenbeauftragten mit einer Fachkraft wird wohl dem Amt nicht gerecht, das ganz bewusst ein politisches Amt ist. Die Hauptforderung und der Kern der Abhandlung ist die Forderung zur Freigabe weiterer Drogen, insbesondere Cannabis.
Der vorliegende Titel gibt dem Laien einen sehr guten Überblick über Rauschmittel, deren medizinische und chemische Wirkung und Gefahren. Viele Informationen lassen sich auch dank des Sachregisters schnell finden, über 100 Endnoten laden zum Weiterrecherchieren ein. Sechs Seiten Anleitung zur Ersten Hilfe bei Rauschgift-Notfällen können hilfreich sein. Die solitäre Stellung des Alkohols im Rausch- und Suchtsystem wird sehr anschaulich herausgearbeitet.
Was das Anliegen des Autors angeht, ist der Titel des erfahrenen Mediziners eher kontraproduktiv, denn er geht von der Prämisse aus, dass Rausch für den Menschen notwendig ist. Hier schreibt ein Theoretiker ÜBER Sucht und Suchtmittel, wie es die medizinische und andere Literatur eben schildern, ein Drittel seiner Literaturhinweise sind Titel aus einem Verlag, der sich mit „Rauschkultur“ befasst. Ein von der Sucht betroffener Mensch wird seiner Prämisse evidenzbasiert widersprechen, denn jeder Rausch schadet dem Hirn. Das Eintreten für die Legalisierung von Cannabis und LSD fügt dem Kanon der sich heute schon legal in Umlauf befindlichen Rauschmittel, flüssig oder in Pillenform, weitere Gehirnlöscher hinzu. Ziel muss es sein, den Rausch zu entmythologisieren und die beiden Begriffe Genuss und Kultur vom Rausch zu entkoppeln. Wenn man dies im Hinterkopf hat, kann das Lesen dieser Abhandlung ein Gewinn sein.
Torsten Hübler
Dr. Gernot Rücker, Rausch, Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann, 272 Seiten, geb., Mosaik, München, ISBN 978-3-442-39404-3, 22,00 Euro
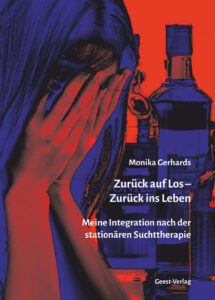
Zurück auf Los – zurück ins Leben
Und wieder ein Büchlein, das eigene Erfahrungen schildert und ermutigt: zum Trockenwerden, zum Trockenbleiben. Wie andere vorher auch, kann es unschätzbar wertvoll werden für jeden, der sich auf den Weg macht in die Abstinenz, denn solche Bücher können buchstäblich Leben retten und erhalten …
Autorin Monika Gerhards hatte fünf Jahre „Rumgehampel“, so nennt sie es, hinter sich: Sechs Entgiftungen, eine abgebrochene ambulante Therapie, zwei Jahre Kreuzbundgruppe, als sie in die Langzeittherapie in einer Klinik startet. Nach den für sie harten und lehrreichen Monaten unter der Käseglocke aber hat sie Angst vor dem Leben draußen. Sie will endlich für immer trocken bleiben, aber wie soll das denn gehen, zuhause im alten Leben? Davon handelt ihr erstes Kapitel.
Der Hauptteil dann besteht aus ihren damaligen Tagebucheinträgen zur Zeit der Nachsorgegruppe. Damit lässt sie uns lebendig teilhaben an ihren Ängsten und Sorgen, an Einsamkeitsgefühlen, an schweren Situationen wie der Krankheit ihres Vaters, die lebensbedrohliche Erkrankung einer der beiden Töchter, dem fast herzzerbrechenden Auszug der anderen, ihrer vorerst erfolglosen Suche nach einem Job, an Krisen in der Kreuzbundgruppe und so weiter. Authentisch, in damaliger Echtzeit für sich selbst niedergeschrieben. Viele, viele Situationen bringen sie in Rückfallgefahr – doch sie meistert alle trocken. Wie nur? „Ich lernte immer besser, mit schwierigen Situationen ohne Alkohol auszukommen. Ich konnte zum Telefonhörer greifen und um Hilfe schreien. Ich fuhr nicht zur Tanke. Ich schaltete den Kopf ein und bedachte die Konsequenzen. Entwickelte Strategien und Techniken, die mich trocken hielten …“ Und der Lesende erfährt hautnah und tagesgenau, welche das waren und sind.
Aber lesen Sie selbst, begleiten Sie Monika durch all die Fallen, die im normalen Alltag nach der Rückkehr für einen Betroffenen lauern können – und erkennen und meistern Sie gemeinsam mit ihr auf diese Weise vielleicht auch Ihre eigenen.
Und das ist es auch, was Monika möchte: Sie, ja, genau Sie unterstützen auf Ihrem abstinenten Weg.
Anja Wilhelm
Zurück auf Los – zurück ins Leben, Meine Integration nach der stationären Suchttherapie, MONIKA GERHARDS, TB, Geest Verlag, ISBN 978-3-86685-932-6, 11 Euro
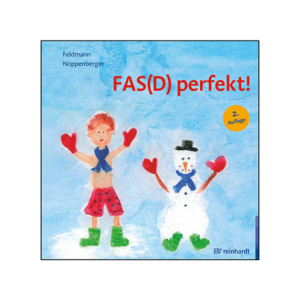
Mo ist FAS(D) perfekt!
Wenn dieses Büchlein in den Frauenarzt-Praxen liegen würde für alle werdenden Mütter … wären vielleicht so einige Kinder wie Mo, die Titelfigur des bunten Bilderbuches, völlig gesund geboren worden. Und nicht mit dem Fetalen Alkoholsyndrom bzw. der Fetalen Alkoholspektrumsstörung, (FAS), mit der jedes Jahr in Deutschland mehr als 2000 Kinder auf die Welt kommen müssen. Und warum? Weil in der Schwangerschaft Alkohol getrunken wurde. Oft auch aus Unwissenheit. Erst seit den letzten Forschungen weiß man, dass sogar auch ein gelegentliches Glas Rotwein solche Schäden anrichten kann.
Was das Gift Alkohol vor allem im Gehirn eines Ungeborenen zerstört – aber auch z.B. am Skelett, am Äußeren, an inneren Organen – beschreibt das Buch im zweiten Teil, in dem für die Erwachsenen, genauer. Denn es richtet sich nicht nur an betroffene Kinder wie Mo, sondern auch an Eltern, Lehrer, Erzieher und Pflegekräfte. Anschaulich wird auf den letzten Seiten nicht nur die Geschichte der Forschung zu FASD erklärt, sondern vor allem auch, wie und warum FASD-Kinder so anders sind, um sie besser zu verstehen: Sie vergessen oft sehr schnell, von jetzt auf gleich – auch Regeln. Was oft als ungezogen und aufsässig verurteilt wird. Sie lernen schwer, und gelten deshalb oft als faul. Sie sitzen nicht gern still, sind arglos und naiv, können Folgen ihres Handelns nicht voraussehen und Gefahren nicht abschätzen, deshalb kennen sie kaum Furcht. Sie sind anders – und anders als pädagogische Erziehung benötigen sie vor allem Verständnis und sehr, sehr viel Geduld. Die Autoren appellieren an alle Betreuenden und das Umfeld, das Selbstwertgefühl dieser Kinder zu stärken und sie vor allem zu behüten, statt ihnen mit ständigen Vorhaltungen und Kritik oder gar Strafen zu begegnen. Und sie geben Alltagstipps dazu.
Der kleine Mo erzählt im ersten Teil zu schön gemalten Bildern seine Geschichte, wie es ihm oft schlecht ergeht in der Schule, wie er ungewollt Menschen ärgerlich macht, warum ihm neulich ein Zelt abgebrannt ist usw. – aber auch, wie ihn seine Pflegeeltern trotzdem sehr liebhaben und wie sehr er die Gesellschaft von Kindern, die so sind wie er, genießt. Und dass jeder von ihnen eben etwas anderes besonders gut kann. Mo z.B. ist der beste Baumkletterer weit und breit. Sein Fazit: „Ich wünsche allen FAS(D)-Kindern und mir, dass man uns versteht, hilft, beschützt und genauso liebhat, wie wir eben sind! Wir alle sind FAS/D) perfekt.“
Ich jedenfalls habe einen ganz besonderen Einblick bekommen: Menschenkinder, die etwas anders „ticken“, als das Umfeld es gerne hätte oder für normal hält, wollen damit nicht andere böse ärgern, auch wenn es so aussieht – sie sind eben einfach anders. Ich verstehe plötzlich besser, nicht nur FASD-Kinder. Jeder ist anders.
Also, wie schon gesagt, es wäre wundervoll, wenn das Büchlein in jede Frauenarztpraxis käme …
Anja Wilhelm
FAS(D) perfekt, REINHOLD FELDMANN/ANKE NOPPENBERGER, Ernst Reinhardt Verlag München, 2. Auflage, ISBN 978-3-497-02873-3, 24,90 Euro
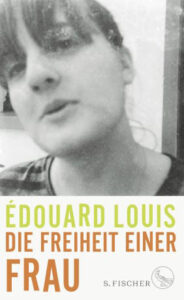 Die Freiheit einer Frau
Die Freiheit einer Frau
Édouard Louis, 1991 geboren, erzählt bereits in seinem 2015 erschienen autobiographischen Debütroman „Das Ende von Eddy“ von seiner Kindheit und Flucht aus prekärsten Verhältnissen in einem nordfranzösischen Dorf. Und auch in den nachfolgenden Erzählungen kehrt er in seine Vergangenheit zurück, die geprägt war von Gewalt, Armut, Erniedrigung, von Co-Abhängigkeit, psychischen Verletzungen, Verlassen-Werden, Ausgrenzung als Homosexueller. Louis Bücher sind Lebensberichte als auch politische Manifeste.
Das Schicksal der Mutter in „Die Freiheit einer Frau“ (2021) beschreibt er in fast zärtlichem Ton und versucht zugleich, eine Erklärung dafür zu finden, warum seine Mutter so viel vom Leben wollte, aber kaum etwas bekam …
Die Mutter hatte sich gerade von ihrem ersten Mann getrennt, einem Alkoholiker, der durch zwei Schwangerschaften versuchte, die Frau an sich zu ketten. Sklavisch zu allem Haushalt verurteilt, träumte sie von einer Ausbildung zur Köchin, idealerweise auf einer Hotelfachschule. Doch aus dem Traum wird nichts. Denn da ist der zweite Mann, auch ein Alkoholiker und ebenso darauf bedacht, sie nicht arbeiten gehen zu lassen, auf das sie zu Hause voll funktioniere und ihm gnadenlos diene. Für ihn war die Ehefrau nur „eine dumme Kuh“, ein „fettes Stück“. Hatten ihrem Ehemann die harte körperliche Arbeit und das unzureichende Sozialsystem „die Luft genommen“, so ist es nun er, der die Gewalt eine soziale Hierarchiestufe weiter nach unten reicht. Drei weitere Kinder werden geboren, unter ihnen auch der Erzähler.
Édouard entkommt diesen Verhältnissen, studiert Soziologie und wird ein erfolgreicher Schriftsteller. Und die Mutter inzwischen? Sie unternimmt einen zweiten Ausbruchsversuch: Sie packt die Sachen ihres Mannes in Müllsäcke, schmeißt sie vor die Haustür, schließt ab, und als der nach Hause kommt und gewaltig gegen die Wände schlägt, bleibt sie standhaft. „Er hat geweint, aber ich hab zu mir gesagt, Du gibst nicht nach. Du gibst nicht nach. Schluss mit dem Nachgeben.“ Und der Sohn ermutigt seine Mutter.
Louis wendet sich mal direkt an die Mutter, im nächsten Moment nimmt er ihre Perspektive ein, dann wieder schreibt er über sie in der dritten Person. Er entschuldigt sich bei ihr dafür, dass er sich ihrer schämte, dass er sich – als Gymnasiast – für etwas Besseres hielt und dafür, dass er sie aufgegeben hatte.
„Das Hin und Her zum und vom Lebensmittelladen des Dorfs, die Zubereitung der Mahlzeiten, dass ihre Kinder ihr eigenes Leben nachlebten, die Ödnis des Landlebens, die Gemeinheiten meines Vaters ihr gegenüber. Sie war erst um die vierzig, aber es sollte nichts Neues mehr kommen. Und genau in dem Moment, als ich innerlich diesen Gedanken formulierte, änderte sich alles.“
Die Mutter verlässt ihren zweiten Mann. Sie verdient ihr eigenes Geld, indem sie alten Leuten beim Putzen, Waschen und Anziehen hilft. „Ich bin keine Putzfrau, aufgepasst, ich bin Haushaltshilfe, das ist fast so gut wie Krankenschwester. (…) Da siehst du mal, wie gut ich zurechtkomme (…).“ Und der Autor kommentiert: „Es rührte mich, dich glücklich zu sehen.“ Die Selbstbefreiung der Mutter verändert auch seinen Blick auf die Kindheit.
Mich hat die emphatische Zärtlichkeit der Sprache, die der Autor seiner Klasse, denen, die ihn auch unterdrückt haben, in eindrücklichen Bildern entgegenbringt, sehr berührt. Es ist die treffsichere Wortauswahl, die das Geschehen so nachfühlbar macht. Es ist die Offenherzigkeit, mit der der Autor seine „Ratlosigkeit“ formuliert. Doch die Zeilen, mit denen sich Louis im Buch direkt an seine Mutter wendet, gehören zu den anrührendsten. Die gewachsene Freundschaft zu ihr hat für ihn, der ohne Fürsorge aufwuchs, einen existenziellen Wert. Dies ist es, was das kleine Bändchen zu einer großartigen Erzählung wachsen ließ.
Mit einer gnadenlos beschriebenen unschönen Realität eröffnet der Autor einen Blick in eine Welt, vor der immer noch viel zu viele Menschen lieber die Augen verschließen möchten. Schreiben ist Louis Kampf gegen soziale Gewalt.
Édouard Louis setzt sich mit der Literatengilde ebenso auseinander: „Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre er eine Messerklinge. Denn jetzt weiß ich es, sie haben das, was sie Literatur nennen, gegen solche Leben und solche Körper wie den ihren, wie den meiner Mutter konstruiert. Denn jetzt weiß ich es, künftig über sie und über ihr Leben zu schreiben, das heißt, gegen die Literatur anzuschreiben.“
Mit diesem kleinen, stillen Buch tritt eine Frau aus der Unsichtbarkeit …
Hans-Jürgen Schwebke
ÉDOUARD LOUIS: Die Freiheit einer Frau, S. Fischer Verlage, Frankfurt/M. 2021, 96 S., 17,- €, ISBN: 978-3-10-000064-4
Immer noch kein Roman
Ahnes Autobiographie: Wie ich einmal lebte
Nach den vier Bänden „Zwiegespräche mit Gott“ und dem Titel „Wieder kein Roman“ und sieben weiteren Büchern legt hier der Berliner Surfpoet und Schriftsteller Ahne nun einen Versuch über die Beschreibung seines Lebens vor.
Es geht dieses Mal weniger um Gott als um Ahnes Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden in Ostberlin, als es das noch gab, in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts.
Kindheit, Familie, zehn Jahre Wladimir-Lomonossow-Schule in Karlshorst, Druckerlehre beim Neuen Deutschland, Armeezeit, Arbeit und ein bisschen Subkultur sind die Themen, die der Leserin, dem Leser ein Panorama der ostdeutschen Realität und Befindlichkeiten liefern. Persönlich geht es um sein Hirngespinst eines von ihm entdeckten eigenen Kontinents, später auch um seine erste Liebe. Ahne stellt sein Leben als Mitläufer, weder Widerstandskämpfer noch Unterstützer des Systems, dar. Es passiert nichts Aufregendes in diesem Buch, ein graues Ostberlin in einer grauen DDR und darin die graue Maus Ahne, so war scheinbar die DDR.
Wer sich für das „normale“ Leben der Menschen in der DDR interessiert, der findet hier einen Zeitzeugen für die letzte Hälfte des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik. Die Lebensbeschreibung endet im Oktober 1989, kurz vor dem Fall der Mauer
Torsten Hübler
AHNE, Wie ich einmal lebte, 270S., 1. Aufl., Festeinband, Verlag Voland & Quist, Berlin, ISBN 978-3-86391-380-9, 26,00 EUR
In guten wie in schlechten Zeiten?
Eben dieses Ehe-Versprechen ist es, nur zum Beispiel, weswegen Laura (zu) vieles über lange Zeit erträgt: Die Schläge ihres alkoholkranken Mannes, die oft blutig enden. Gebrüll, Beleidigungen. Ihre zwei Kinder müssen alles mit ansehen und auch sie erleben Gewalt. Laura wird krank, leidet an Depressionen, die Kinder wissen nicht mehr, was Lachen und Spielfreude sind. Die drei leben in Angst …
Warum, warum nur lässt Laura das zu, möchte man als Leserin wissen? Weshalb geht sie nicht? Trennt sich nicht?
Ihr einst so liebevoller Ehemann Holger, sie glaubt, ihn trotz allem zu lieben, tut ihr immer wieder leid. Er würde doch ohne sie noch tiefer fallen? Und ohne Alkohol war er doch ihr lieber Mensch wie früher? Er brauchte doch ihre Hilfe? Sie schämt sich für ihren Mann, für die zerrüttete Ehe und redet nur mit ihrer Mutter und ihrem Chef darüber, beide haben ihre Erfahrungen nämlich einst auch gemacht. Schließlich bringt sie ihn dazu, zu entgiften, sogar bis zu einer 12-Wochentherapie. Danach aber reiht sich ein Rückfall an den nächsten, dazwischen liegen gute Zeiten, die ihr immer wieder Hoffnung geben.
Nach einem besonders grässlichen Vorfall, er wirft den kleinen Sohn zu Boden, der seine Mutter beschützen will, fasst Laura den Entschluss und beantragt die Scheidung.
Wie es für beide weitergeht? Das können Sie vielleicht selbst lesen …
Dieser dritte Band von Steffen Krumm beleuchtet diesmal nicht seine eigenen realen Erlebnisse und Erfahrungen als schwer Alkoholkranker. Sie fließen aber mit ein, wenn er Holgers süchtiges Verhalten beschreibt. Vielmehr hat der Autor zur Recherche mit vielen co-abhängigen Menschen gesprochen. Aus all dem entstand diese Erzählung, die eher ein bisschen an eine fiktive Dokumentation erinnert, vom Schreibstil her.
Die Antwort auf die Eingangsfrage, warum Laura so lange bei ihrem suchtkranken Mann blieb, erschließt sich dem Lesenden im Laufe des Buches. Am Ende erklärt der Autor noch ein bisschen mehr zur Co-Abhängigkeit. Und appelliert an die Verantwortlichen in diesem Land und auch an uns, gezielter darüber aufzuklären und die betroffenen Menschen nicht allein zu lassen.
Lieber Steffen, danke dafür, dass du den oft einsam über viele Jahre hinweg leidenden Frauen (und auch Männern) und Kindern eine „Bühne“ gebaut hast mit Deinem Buch. Da kann und sollte man dann über die oft deplatzierte Zeichensetzung mal hinwegschauen, sie wird ziemlich unwichtig (lächel).
Anja Wilhelm
STEFFEN KRUMM, Sucht ist stärker als Liebe, New Dreams Verlag, Independently published, TB, 158 Seiten, 8,90 Euro
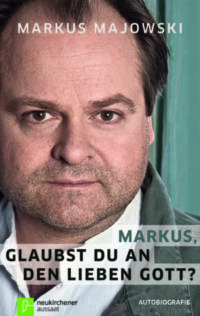 Markus, glaubst Du an den lieben Gott?
Markus, glaubst Du an den lieben Gott?
Wenn ein Komödiant ein Buch schreibt, was erwarten Sie da, liebe LeserInnen? Ganz was Lustiges, oder nicht? Auf jeder Seite viel zum Lachen?
Aber Markus Majowski ist auch nur ein Mensch – ein Comedy-Star auf Bühne und im TV hat auch noch ein Leben hinter der Show. Ein „echtes“ Leben. Das fließt und floss mitnichten nur immer lustig und heiter dahin. Natürlich gibt’s auch viele, viele Anekdoten zum Grinsenmüssen, na klar beschreibt er auch Geschichten auf seine Weise, die die Mundwinkel unweigerlich nach oben ziehen. Ich habe jedenfalls sehr oft geschmunzelt im Verlauf der 200 Seiten. Schon am Anfang, als seine Frau Barbara in ihrem liebevollen Vorwort beschreibt: „Immer klappert oder scheppert etwas, wenn Markus in der Nähe ist …“ oder er fragt Dinge wie: „,Liebling, wo stehen bei uns die Gläser?‘, ,Was ist heute für ein Tag?‘, Wo bin ich?‘“. Ja, so ein bissel verschusselt ist er eben nicht nur auf Bühne und Bildschirm, sondern in echt. Verträumt. Mit den Gedanken ganz woanders. Und das ADHS tut seines noch dazu.
Außerdem ist er im echten Leben drogen- und alkoholkrank und bisexuell und sehr gläubig. Punkt. Dieses Buch, 2013 erschienen, ist sein damaliges Outcoming – und noch ganz vieles mehr …
Aufgewachsen als schon damals ein Wonneproppen, wie er schreibt, ist er in einer begüterten Westberliner Familie, der Vater war Cellist bei den Berliner Philharmonikern. Markus fehlt es an nichts. Auch nicht an absoluter Liebe. Und Harmonie. Aber dennoch oder deshalb … er hat nicht gelernt, mit Widerstand und widrigen Umständen umzugehen. Das bringt ihn viele Jahre, Jahrzehnte immer wieder in Schwierigkeiten. Bis hin zum Drogen- Alkoholmissbrauch.
Sein beruflicher Werdegang beginnt eher noch nicht so verheißungsvoll. Auf kleinen Bühnen. Er lebt in WGs, schuftet in einer Restaurantküche nebenher. Dann als Komiker und Schauspieler erst einmal entdeckt, startet er voll durch. Tourneen, Filme, Werbung. Aber auch das oft nicht ohne kleine und größere Missgeschicke, ob im Job und im Alltag. Von Rückschlägen oder Schicksalsschlägen bleibt auch er nicht verschont.
Woran er sich im Laufe seines kunterbunten Lebens bis 2012 (er lernt z.B. auch tauchen, findet die Liebe seines Lebens auf einer Tauchreise, wird Vater, schreibt ein Kinderbuch, gründet eine Firma, sorgt sich um trauernde Kinder, stellt seine Ernährung um, nimmt ab, lernt Qigong und, und, und …) wieder erinnert: Er glaubt an Gott. Nur hatte er inzwischen „den Draht“ zu ihm verloren. Markus nimmt ihn wieder auf. Spricht mit ihm, betet täglich. Hört zu. Und übt, in Resonanz zu gehen mit dem, was Gott für ihn vorgesehen hat. Jedenfalls habe ich das so verstanden als Leserin.
Markus Majowski schrieb das Buch, als er bereits einige Jahre trocken war. Diese Rückschau half ihm auch, weiter trocken zu bleiben, sagt er.
Und er sagt noch so, so, so viel!
Wissen Sie was, liebe LeserInnen? Ich werfe jetzt das Handtuch. Und zwar Ihnen zu (keine Sorge, es duftet nach Weichspüler). Sie sollten einfach selbst lesen. Vom prallen Leben, vom Hinfallen und Aufstehen, von Trauer und Schmerz, von Liebe und Glück, erzählt in unverwechselbarem, oft wirklich komischen Majowskisch. Und am Ende haben Sie dann sehr oft mitgefühlt, vor allem mitgegrinst. Und dies auch, kennen Sie diesen Zustand, wenn man lächelt und gleichzeitig aber „Pipi in den Augen“ hat vor Rührung?
Und vielleicht sind Sie dann sogar, wie ich auch, ein Stückchen weiser geworden, mit Markus auf seinem ureigenen Lebensweg …
Übrigens: Sein zweites Buch, erschienen 2021, stellen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe vor: MARKUS, MACH MAL!
Anja Wilhelm
MARKUS MAJOWSKI, Markus, glaubst du an den lieben Gott? Verlag neukirchener aussaat, 2013, Geb., 200 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-7615-6035-8
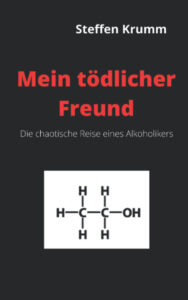 Mein tödlicher Freund
Mein tödlicher Freund
Kein mahnend und lehrmeisterlich erhobener Zeigefinger, nirgendwo im Buch …
Auch darin unterscheidet sich dieses Erfahrungsbuch im Selbstverlag von einigen anderen Alkoholiker-Erfahrungsbüchern. Ja, es mahnt und erschüttert – und das teilweise bis ins Mark – aber einzig durch seine sachliche, undramatische Schilderung von hoch dramatischen Situationen und Fakten.
Was ich damit meine?
Steffen Krumm begann schon mit 15 seinen ersten „Selbstversuch“ mit einer kleinen Flasche Kirschlikör. Es war an einem Wochenende. Er wollte herausfinden, was seinen trinkenden Stiefvater oftmals aggressiv machte und andere Familienmitglieder wiederum ausgelassen … der Alkohol tat seine Wirkung. Vorerst positive. Und half auch gegen seine Ängste. Das kennen wir alle.
Mit 18 lernte er das erste Mal Entzugssymptome kennen. Mit 21 landete er zum ersten Mal auf einer Entgiftungsstation.
Unzählige weitere Entgiftungen folgten … Rückfälle, Arbeitsplatzverlust, Scheidung, Obdachlosigkeit und dazu die Abhängigkeit von Benzos. Irgendwann aber machte es klick und er blieb neun Jahre trocken. Bis zu einem Rückfall, der ihn fast das Leben kostete. Der Rettungsdienst konnte ihn reanimieren.
Seit einer Therapie und betreutem Wohnen ist er nun wieder trocken, clean und begann ein ganz neues Leben. Sein neu gefundener Glauben half ihm dabei. Er hat eine Wohnung, einen Job, und sogar mit seiner Exfrau ist er wieder zusammen. Das Schreiben des Buches war für ihn Teil seiner Therapie.
Vieles Geschilderte ist für trockene LeserInnen nicht ganz neu. Aber ob jemand von Ihnen sooo weit unten war? Steffen Krumm schildert detailliert, wie eine Party über Tage und Nächte verlief. Nachdem sich ein paar Leute, gerade aus der Entgiftungsstation gekommen, sofort wieder zudröhnten bei ihm Zuhause, als er noch eins hatte (nach der Party nicht mehr). Wie sie die letzten Tropfen aus den Flaschen zusammenkratzten, um ihr Zittern zu bekämpfen, After Shave tranken und Schlimmeres, kein Geld mehr hatten, Klauen gingen in den Supermarkt, wenn überhaupt noch jemand laufen konnte. Was mit seinem Körper geschah. Mit einer Psyche. Wie er sich selbst verdammte. Wie er Alkohol trinken MUSSTE … und am liebsten sterben wollte.
Die glasklare Schilderung seines Delirs erschütterte mich am meisten.
Am Ende beschreibt er mit eigenen, gut verständlichen Worten für einen Laien, was Sucht ist. Und dass die rote Linie zwischen Missbrauch und Sucht oft nicht sichtbar ist für den einzelnen.
Ich empfehle dieses Büchlein unbedingt!
Der noch Trinkende wird es nicht lesen wollen, es wäre wie ein Blick in den Spiegel, in den er nicht schauen will. Aber für den Trockenen kann es Erinnerung und Mahnung sein, es wirkt wie eine Art Rückfallprävention. Für Freunde und Angehörige von Abhängigen ist es fast Pflichtlektüre, wenn sie unbedingt verstehen wollen, warum Sucht keine Willens- oder Charakterfrage ist, sondern eine Krankheit ist …
Diesem Buch folgen noch zwei weitere Teile. Die lese ich für Sie gerne bis zur nächsten Ausgabe der TrokkenPresse.
Anja Wilhelm
STEFFEN KRUMM, Mein tödlicher Freund, NewDreams Verlag Steffen Krumm, (steffenk67@gmail.com), 196 S., 8,90 Euro, ISBN: 978-1695600911
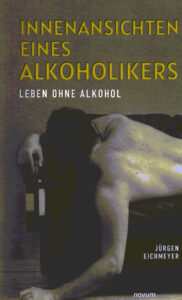 Rückschau eines 83-Jährigen
Rückschau eines 83-Jährigen
Ein anderes „Wirtschafts“wunder
Der 1939 geborene Autor blickt zurück auf ein erst unglückliches, dann alkoholgetränktes und später abstinent-glückliches Leben.
Josef Schutzmeyer beginnt mit dem Leben seiner Eltern. Von seinem Vater Heinrich erfährt man, dass er Polizist und Parteimitglied der NSDAP war. Von seiner Mutter Maria erfährt man, dass sie aus Braunau (heute Broumov in der Tschechischen Republik) stammt und chemisch-technische Assistentin war. Die Familienverhältnisse der Mutter werden ausgebreitet, die Großtanten Hermine, Johanna und Marie, die Onkel Franz und Karl. Der Kurort, in dem der Vater die Mutter kennenlernte, wird beschrieben. Der Umzug nach dem Krieg nach Westdeutschland, Niedersachsen. Hier wird die Kindheit von Josef erzählt, dass er in der Schule keine Leuchte war und sein Vater des Öfteren sagte, dass er lebensunfähig wäre und es ein böses Ende mit ihm nähme. Er schildert seine Zeit als Heranwachsender im dörflichen und familiären Umfeld, die Schule, die Lehre, die Tanzschule, den ersten Alkohol. Hier ist schon fast die Hälfte des Buches durchschritten.
Zur neu gegründeten Bundeswehr meldet sich Josef freiwillig. Hier ist Bier ein normales Getränk, gerne auch in größeren Mengen getrunken. Nach seiner Dienstzeit nimmt er den erlernten Beruf in der Schuhhandelsbranche wieder auf, wechselt aber mehrfach den Arbeitgeber, wird Filialleiter eines großen Schuhhauses. Anschließend wechselt er in den Außendienst für einen Schuhhersteller. Nun kommt er richtig ins Saufen, fünf Tage in der Woche, alleine im Hotel und ständig Kundenkontakte erleichtern den Alkoholkonsum. Eine Trunkenheitsfahrt mit dem Geschäftswagen und 2,2 Promille endet im Graben und hat ein einjähriges Fahrverbot zur Folge und damit ist auch der Arbeitsplatz im Außendienst im Strudel des Alkohols untergegangen.
So kam er ins väterliche Geschäft, als Teilhaber und billige und willige Arbeitskraft. Diese Episode endete mit einem Zerwürfnis mit dem Vater, nachdem er seinen Führerschein zurückerhalten hatte. Er ging wieder in den Außendienst für eine Schuhfabrik. Mittlerweile hat Josef mit seiner Frau Gudrun zwei Kinder.
In der Erinnerung von Josef wurde in dieser Zeit immer und überall Alkohol getrunken, außer beim Frühstück, auch Josefs Frau Gudrun trinkt gerne mit. Josef bemerkt aber bei sich Abhängigkeitssymptome, weiß aber damit nicht anders umzugehen als weiter zu saufen. Dann versucht er, mittels kaltem Entzug dem Alkohol zu entfliehen, mit grausigen Entzugserscheinungen, deren Überwindung, einmal überstanden, mit „nur einem Korn und einem Pils“ belohnt werden.
Der Protagonist arbeitet nun als Fachberater in der Flachdachbranche, da die deutsche Schuhindustrie zu ihrem Ende kommt, und trinkt weiter, die Familie, die Kunden, die Vorgesetzten sehen über seine zitternden Hände und seine sich über den Tag steigernde Fahne hinweg, solange er funktioniert. Für ihn geht es aufwärts, bald steht das Eigenheim, er macht sich selbstständig, geht pleite und verliert aufs Neue bei einer Alkoholfahrt den Führerschein.
Ein Arzt verschreibt ihm Antabus, das aber nicht nachhaltig auf sein Suchtverhalten wirkt. Nach weiteren Eskapaden zieht sein Bruder, Psychologe, die Notbremse und schickt ihn in eine Selbsthilfegruppe.
Gruppe hilft, auch hier. Wie es weitergeht mit Josef, können Sie im Büchlein nachlesen.
JÜRGEN EICHMEYER, Innenansichten eines Alkoholikers, Leben ohne Alkohol, 96 Seiten, Softcover, novum Verlag, ISBN 978-3-99130-053-3, 15,50 Euro
