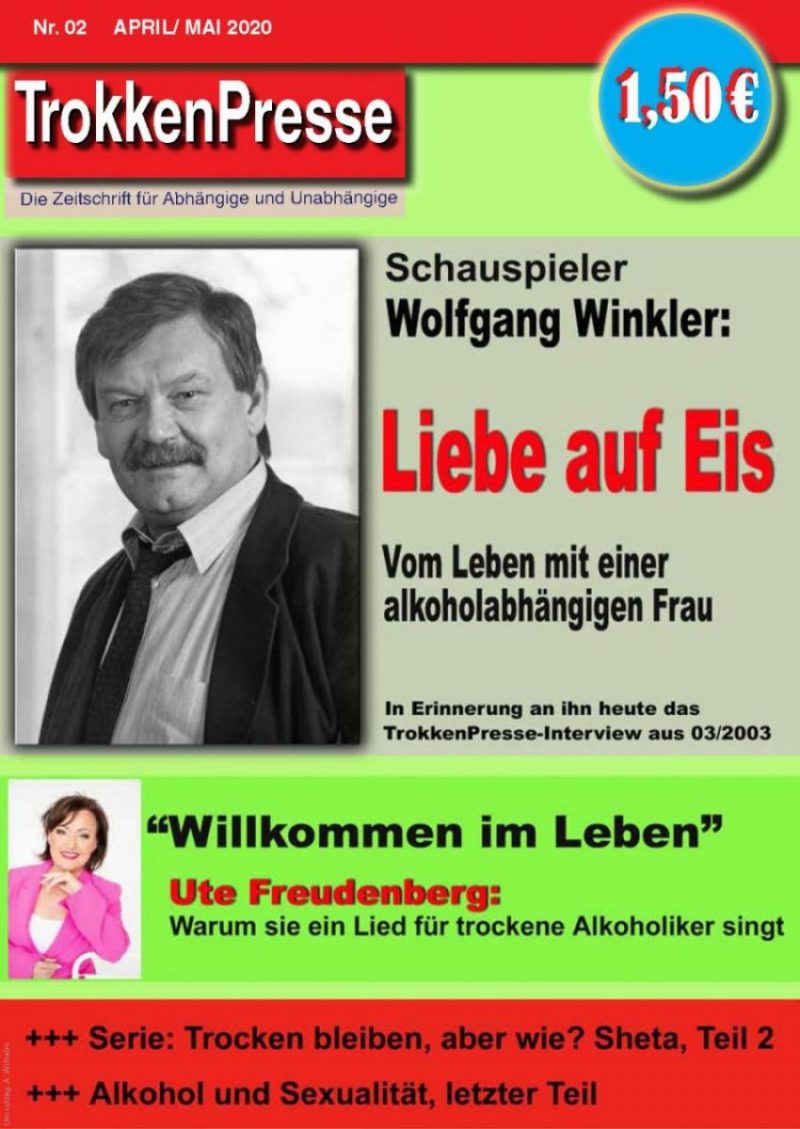Serie: „Trocken bleiben – aber wie?“
Ich darf nochmal leben!
Seit fünf Jahren stellen wir Menschen vor, die seit einiger Zeit trocken leben. Wir wollen wissen, wie sie das erreicht haben, jeden Tag aufs Neue, bis daraus Monate und Jahre wurden. Ihre Erfahrungen können vielleicht dem einen oder anderen Betroffenen auch hilfreich sein. Für den folgenden Text haben wir mit Nancy aus Niedersachsen telefoniert und ihre Erfahrungen dann für sie und Sie aufgeschrieben.
Ich hatte gestern einen meiner drei Geburtstage im Jahr. Neben dem originalen und dem Tag meiner Notoperation ist mir der Trockengeburtstag der allerwichtigste überhaupt. Ich bin sooo dankbar dafür!
Ich hatte an diesem Tag vor zwei Jahren endlich ein Bett in einer Entgiftungsstation bekommen. Seitdem bin ich trocken. Vor allem auch dank der Facebook-Gruppe „Alkohol – Gemeinsam gegen die Sucht“. Dort habe ich viel lernen dürfen aus den Erfahrungen der anderen. Und 24 Stunden ist immer jemand da. Die ersten zwei Wochen waren nämlich wirklich schlimm, und da habe ich mir das zu Herzen genommen, was ich dort las. Es heißt ja, gute 24 Stunden das Glas stehen lassen … aber der besondere Tipp war: Wenn es ganz dicke kommt, mach eine Stunde daraus. Und wenn die um ist, wieder eine Stunde. Ich habe für mich daraus immer 30 Minuten gemacht, die ersten Wochen nach der Entgiftung. Ah, und wenn ich die geschafft hatte, dachte ich, dann schaffst du bestimmt die nächsten 30 auch. Das hat mich gerettet.
Nach einem Jahr ohne Rückfall hatte ich dann auch eine ambulante Therapie bei der Caritas angefangen, aber die Bahnverbindung war zu schlecht, drei Stunden habe ich dahin gebraucht, dazu ständige Zugausfälle. Also abgebrochen. Die Therapeutin sagte: Sonst heiße ich das nicht für gut, aber in Ihrem Fall bejahe ich das, denn Sie kamen hier schon mit einem sehr guten Fundament an durch ihre Facebookgruppe, ihre Gruppe vor Ort und die Suchtberatung und deshalb bin ich sicher, sie werden ihren Weg gehen.
Der Alkohol und ich
In meiner Jugend war ich einmal so richtig besoffen, danach habe 15 Jahre keinen Alkohol getrunken. 2010 dann saß ich wiedermal einsam in meiner Wohnung und dachte, könntest ja mal ein Schorle trinken. Damit hat es angefangen. Dann habe ich auch mit meinen Freunden getrunken. Und zuhause täglich. Ich hatte nie was auf dem Tisch stehen, sondern immer nur im Glas auf der Küchentheke neben dem Kühlschrank, immer ein Schluck Wein oder später Bier vor und ein Schluck nach der Zigarette … bis es irgendwann zwei Liter Wein am Tag wurden. Mit einem Hauch Wasser drin, denn brauchste nicht mal zu erwähnen, so ein Hauch war da drin. Wein hat viele Kalorien, also bin ich umgestiegen auf Bier. Im Höchstfall habe ich auch mal vier bis fünf Liter davon am Tag geschafft, sonntags meist. Ich habe aber immer erst getrunken, wenn alles am Tag erledigt war. So war mein Zuhause mein Gefängnis, das ich mir selber geschaffen hatte.
Ich hatte schon mal zwei Entgiftungen hinter mir. Danach habe ich es immer mit alkoholfreiem Bier und Wein versucht. Und war schnell wieder bei den prozentigen Sachen. Auch mit Baclofen habe ich es probiert. Es half nur die ersten zwei Wochen.
Und vor der letzten Entgiftung ging dann gar nichts mehr. Ich war am Ende und habe mir das Bier nur noch reingequält, damit ich keinen kalten Entzug habe – teilweise so, dass mein Stressmagen das gleich wieder rausgebracht hat.
Da war aber dieser Klick schon in meinem Kopf: Ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne. Ich bin seelisch und körperlich abhängig … und gestern und heute Morgen noch standen mir die Tränen in den Augen, dass mir dieser Klick vergönnt war.
Warum ich getrunken habe?
Vielleicht von vorne: Der Alkoholismus liegt wohl in unserer Familie. Mutter, Stiefvater, Onkel, Bruder …man weiß ja nicht, ob es vererbt werden kann, auf jeden Fall vorgelebt. Ich habe eine sehr schlechte Kindheit gehabt. Meine Mutter hat mich geschlagen, bis der Kochlöffel zerbrochen ist. Mein Erzeuger auch. Oma und Opa mütterlicherseits wurden sozusagen meine Eltern, leider sind sie jetzt tot.
Dann hatte ich neun Jahre lang schwere bulämische Magersucht, dann Depressionen – als meine Schilddrüse behandelt wurde, verschwanden sie aber. Später bin ich vier Mal im Jahr zur Krebsvorsorge beim Frauenarzt: Man vermutet einen seltenen Gen-Defekt, ich hatte 19 schwere Krebsvorstufen. Das ist das Gleiche wie bösartiger Krebs, nur dass die Mauer zum Bindegewebe noch intakt ist. Dazu kamen dann Notoperationen, zum Beispiel die Gebärmutterentfernung, nach der ich geheilt sein sollte, aber nix war geheilt. 2008 kam noch die seltenste Form der Akne dazu, mit Lichtwellentherapie in Behandlung. Ich habe einen Gendefekt an der Lunge, einen Herzklappenfehler. Hatte Fuß- und Rippenbruch … so komme ich seit 1998 auf über 50 Operationen.
Und dann eben dieses Alleine-sein. Ich bin jetzt fast 19 Jahre Single, gehe aber nicht auf die Suche, entweder jemand findet mich oder ich finde jemanden.
Aber ich will nicht jammern, es ist so, ich kann es nicht ändern. Es war nur irgendwann alles zu viel für zwei Schultern.
Und dann noch der Streit über meinen Sohn, heute 27, mit Großeltern, dem Vater, dem Jugendamt, ich stand alleine gegen vier Parteien und der Alkohol bot mir seine offenen, falsch-warmen Arme an.
Der Trink-Druck …
… ist heute sehr selten geworden. Die leichte Form ist, wenn die rechte Gehirnhälfte flüstert: Hey, wir beide, heute Nachmittag? Oder wie vor ein paar Tagen, ich hatte einen Termin in der HNO-Ambulanz, da sprang mein Suchtgedächtnis an, ich fühlte mich auf einmal an Alkohol erinnert, weil ich zur nassen Zeit mal dort lag. Da habe ich tief ein- und ausgeatmet, geguckt, was mich unruhig macht, bin stehengeblieben und dann war es auch wieder weg.
Was mir in der ersten, schweren Zeit geholfen hat: Viel essen, viel trinken. Das hatte ich auch aus der Facebookgruppe. Wer einen vollen Magen hat, dem ist nicht nach trinken. Oder aufräumen, irgendwas Unnützes putzen. Mir hat das geholfen: Ich mache jetzt das, dann mach ich die andere Schrankseite weiter, eins nach dem anderen. Ich habe mich abgelenkt, so dass ich dem Gedanken ans Trinken gar keinen Raum geboten habe. Und ich muss sagen, ich habe ein gnädiges Suchtgedächtnis. Ich weiß aber, es kann jederzeit anders kommen, aber dann weiß ich auch, trinken, trinken oder essen oder betrifft es mich hier zuhause, ziehe ich mich an und geh raus.
Ich mache dreimal die Woche Sport, immer 10 Minuten Laufband, normales Gehen, das ist besser für meine Gelenke, und Herz und Lunge funktionieren dadurch schon wieder viel besser als vorher, und Krafttraining im Studio. Ich versuche ein bisschen von dem, was ich durch das Saufen kaputt gemacht habe, vielleicht wieder gutmachen zu können. Ich habe 36 Kilo abgenommen, einfach auch, weil das Bier wegfiel. Ich trinke jeden Tag entweder grünen oder weißen Tee, aber nicht aus dem Beutel, sondern richtige Blütenblätter, koche mir morgens einen Liter frisch geriebenen Ingwer auf, der stärkt meinen Magen. Ich brauche außer meinen Schilddrüsentabletten nun keine anderen Medikamente mehr. Auch nicht mehr die Schlaftabletten, die ich 19 Jahre lang genommen habe, es hat sieben Monate gedauert, sie auszuschleichen. Ja, ich schlafe beschissen, heute Nacht war ich wach von halb 1 bis 2 Uhr. Aber egal, mir würde es im Traume nicht mehr einfallen, irgendwas Chemisches dagegen anzufassen.
Ich bin auch in einem Tanzverein, Hip Hop. Wenn mein Fuß wieder verheilt ist, will ich einen Tanzkurs machen. Ich tanze für mein Leben gern, schon immer. Stöpsel in den Ohren, so kennt man mich auch hier im Ort. Das lenkt auch ab. Musik. Wenn ich meine Musik nicht gehabt hätte, wäre ich heute, glaube ich, nicht mehr.
Als meine Lieblings-Katze Lilly letztes Jahr plötzlich starb, war es das Schlimmste in meinem Leben … ich hatte immer gedacht, wenn ich sie mal gehen lassen muss, würde ich wohl wieder anfangen mit Trinken. Aber mein Suchtgedächtnis ist nicht mal aufgeflammt. Lilly hatte mich noch mehr geliebt, als ich nicht mehr getrunken habe. Dass ich ihr das noch ermöglichen konnte, dass sie mich so kennenlernen durfte … jetzt muss ich gerade wieder weinen … ich habe mir gesagt, was ändert es, Trinken bringt sie nicht wieder. Und sie wäre so traurig darüber. Und ich sage dir, sie ist gestern an meinem zweiten 2. Trockengeburtstag da oben rumgehopst und hat miaut: „Ich habs euch gesagt, sie schafft es. Zwei Jahre und sie fängt nicht an zu trinken, ich bin ganz stolz!“
Nie mehr every bodys darling
Mein Charakter hat sich auch völlig verändert, ich habe an mir gearbeitet und bin irgendwie entspannter geworden. Das Hörbuch „Drauf geschissen! Wie dir endlich egal wird, was die anderen denken“ von Michael Leister höre ich mir immer und immer wieder an. Und er hat vollkommen recht. Was nützt es dir, zu entscheiden, wie andere es gerne hätten und du selber musst dann mit den Konsequenzen leben. Ich wollte immer every bodys darling sein … aber ich kann die Meinung anderer über mich nicht ändern, egal, wie ich es mache, ich würde mich nur verbiegen, damit ich denen gefalle. Heute sehe ich das so: Ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein Mensch. Ich habe mein Herz am rechten Fleck. Ja, ich weiß, Arschlöcher kommen weiter. Aber bis zum Ende ziehe ich das jetzt durch. Ich laufe trotzdem nicht wie ein Holzpfahl durch die Gegend, ich nehme Rücksicht auf andere.
Und egal, was ist, ich lasse die schlechte Laune nie an anderen aus. Die können ja nix dafür. Ich bin Fleischereiverkäuferin und unterhalte immer den ganzen Tresen. Im Positiven, mit Witz und Humor, denn selbst die Leute auf dem Friedhof sagen häufiger Hallo als die Kunden im Einzelhandel. Dann lachen sie meist doch irgendwann.
An Gefühlen stirbt man nicht
Das ist auch aus der Gruppe. Stimmt vollkommen. Egal, was. Und wenn mir danach ist, dann weine ich eben mal kurz. Aber dann ist gut. Dann schnappe ich mir meine Ohrstöpsel und tanze hier durch die Wohnung. Und dann war es das wieder. Und wenn der Kummer noch größer ist, dann rufe ich eine Freundin an oder die Telefonseelsorge, wenn man die Freundin nicht vollsülzen will. Ich habe mir auch das Tagebuchschreiben angewöhnt, seit Lillys Tod. Und das hilft. Die anderen beiden Katzen-Mädels haben ja auch sehr gelitten unter ihrem Verlust. Und dann muss du auch noch den Kummer der beiden tragen.
Und ich kann jetzt übrigens auch gut mit mir alleine sein. Ich bin sogar sehr gern allein inzwischen.
Und so mache ich Tag für Tag.
Ich werde niemals sagen, ich werde nie wieder trinken. Das kann ich nicht, sondern: nur für heute. Aber ich gebe mein Bestes. Und ganz ehrlich, ich führe mir immer vor Augen: Jetzt habe ich ein Leben, das beste Leben, das ich je hatte. Anscheinend kommt wirklich das Beste zum Schluss. Ich würde das alles verlieren, alles, diese Chance krieg ich nicht wieder.
Ich hab ja immer an Gott geglaubt, vielleicht hat er da oben gedacht: Mädchen, du wertschätzt dich zu wenig, den Weg des Alkoholismus musst du gehen, damit du das ändern kannst …
Ich darf noch mal leben. Mein Leben 2.0: ein schönes Zuhause, ich habe zu essen, meine Fixkosten sind alle bezahlt, alles andere ist Luxus. Ich bin in der Lage, mein Leben zu verrichten – es gibt Menschen, die sind schlimmer dran, weißt du, die müssen gegen todbringende Krankheiten kämpfen und wissen nicht, ob sie diesen Kampf gewinnen. Ich habe jetzt noch zwei oder drei Operationen vor mir, aber ok. Ist in Ordnung. Und solange ich keine Hilfe Zuhause brauche für den Rest meines Lebens, bin ich dankbar. Und: Ich muss nicht trinken!
Aufgeschrieben von Anja Wilhelm