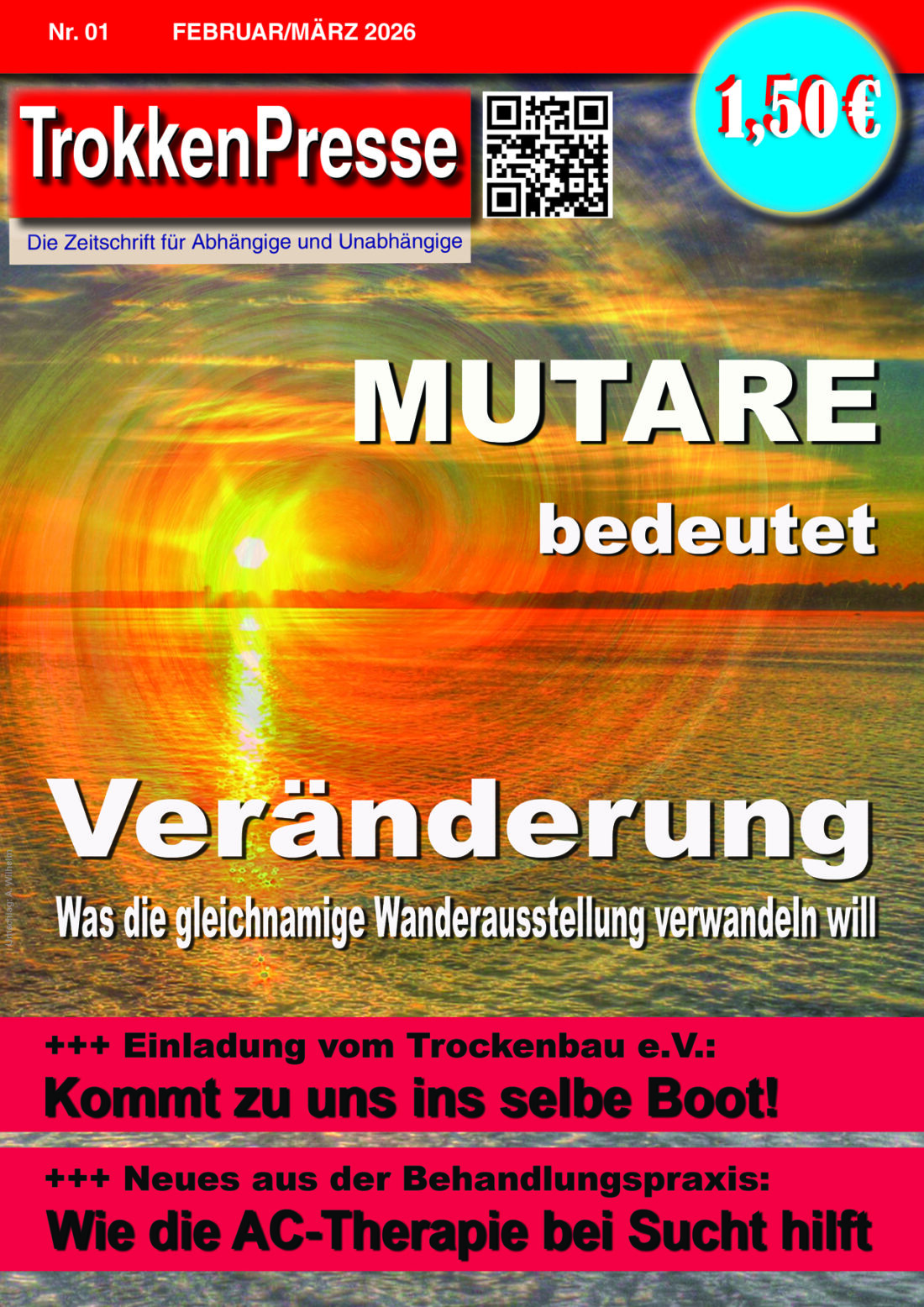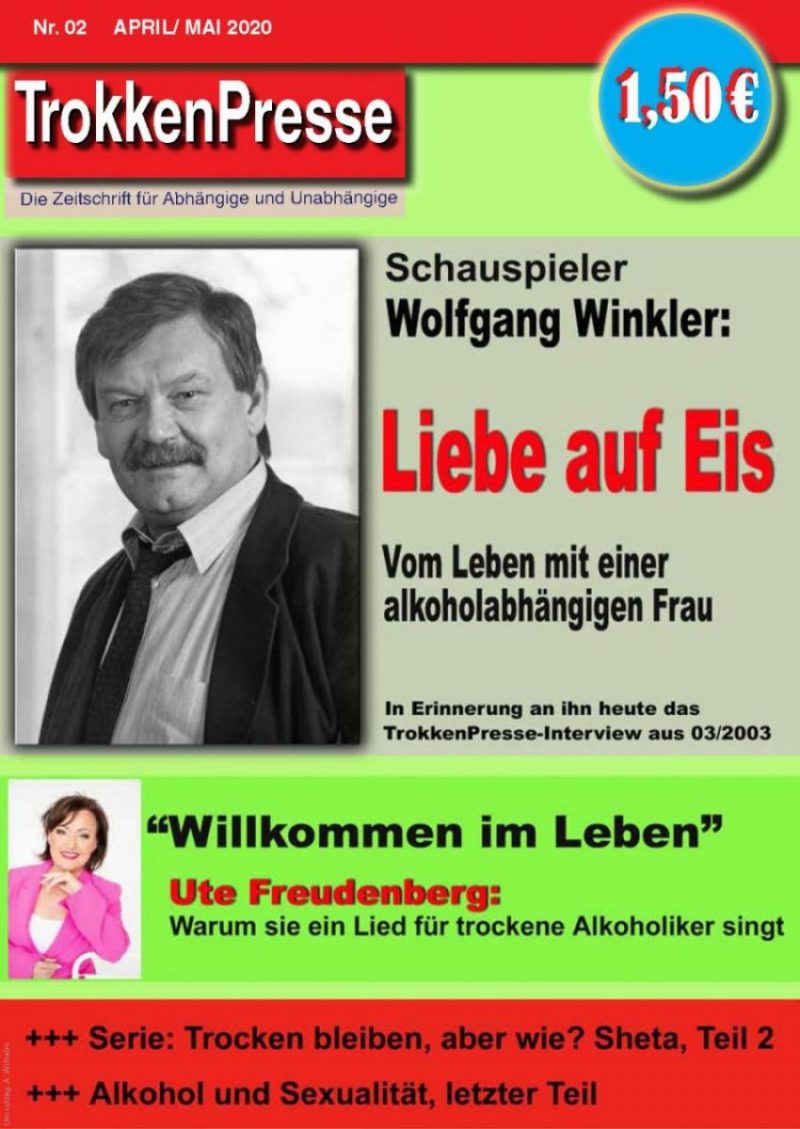Deutsche Suchthilfe im Ausland:
Guttempler helfen Suchtkranken in Uganda
Irgendwo in Afrika … nein, nicht irgendwo. Sondern im 6000 km entfernten Uganda. Dort helfen deutsche Guttempler des FORUT e. V. * suchtkranken und suchthelfenden Einheimischen: So konnte nun eine kleine Rehaklinik für suchtkranke Menschen in Nakabiso, Mpigi-Distrikt nahe der Hauptstadt Kampala, eingeweiht werden, das Center of Excellence for Addiction Treatment von Hope and Beyond
Es ist die bisher einzige professionelle Suchttherapie-Einrichtung in diesem ostafrikanischen Staat, einem der allerärmsten Länder der Welt – der zugleich aber den zweithöchsten Pro-Kopf-Reinalkohol-Konsum auf dem Kontinent hat (nach Nigeria): Laut WHO in 2011 11,9 Liter pro Jahr (Männer 19,93 Liter!). Bier und vor allem selbstgebrannten Schnaps gibt es immer zu kaufen und sie gehören wie selbstverständlich zum Alltag. Geschätzt etwa 23 Prozent der Bevölkerung sind schwere episodische Trinker, sagte ein UN-Bericht von 2006, eine von sehr wenigen Datenerhebungen überhaupt. Wie viele tatsächlich abhängig sind, weiß niemand wirklich. Aber sie alle benötigen Hilfe. Die TrokkenPresse im Gespräch mit FORUT-Schatzmeister Dietmar Klahn aus Hamburg …
Sie sind öfter in Uganda – wie erleben Sie den Alkoholmissbrauch?
Wenn man als normaler Tourist dahin kommt, kriegt man das nicht so mit. Aber wenn man mit Leuten spricht, ist da keiner, der nicht einen kennt, der sich zu Tode getrunken hat oder mehrfach abhängig ist oder heimische Drogen nimmt.
Durch jede Bevölkerungsschicht?
Wir haben Leute in der Klinik, die ihr Studium abbrechen müssen, weil sie mit der Sucht nicht klarkommen und Arbeiter vom Bau oder Leute vom Land, eine große Bandbreite. Und auch viele, viele junge sind dabei. Die Eltern wissen es meist nicht besser, es gibt so kleine Tütchen mit hochprozentigem Alkohol, 40 Volumenprozent, da nuckeln schon die 5-Jährigen dran. Es fehlt das Verständnis dafür, dass das ein Gift ist.
Hat das auch mit fehlender Bildung zu tun?
Eigentlich haben sie ein gutes Schulwesen für ein Entwicklungsland, aber trotzdem 30 Prozent Analphabeten, die meisten davon auf dem Land. Es gibt viele Mythen, die sich um den Alkohol ranken, aber die Hauptursache ist natürlich Unwissen. Wenn man Analphabet ist, kann man nicht einfach mal so sein Smartphone nehmen und googlen. Und auch, wenn jeder ein Telefon hat – in Uganda gibt’s keine mit Vertrag –, wenn der „credit“ aufgebraucht ist, kann man eben nur noch angerufen werden.
Wenn ein süchtiger Trinker Hilfe sucht, wo findet er sie?
Die Menschen haben keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, es gibt keine Träger für Suchthilfe wie bei uns, nix, was irgendwie aufgefangen wird durch den Staat. Was sie kriegen können, ist, dass sie ins zentrale Krankenhaus in Kampala kommen und nach einer Entgiftung stehen sie wieder auf der Straße nach ca. zehn Tagen. Was sollen sie dann machen? Dann sind sie genauso schlau wie vorher. Aber auch, wenn sie in unsere Klinik gehen, muss die Familie sehen, dass sie irgendwie das Geld für die Behandlung auftreibt. Es gibt aber auch Menschen, die „müssen“ nichts bezahlen, wenn sie gar nicht können, dank einer sogenannten Mischkalkulation, einem internen Verrechnungsschlüssel – es sind ja auch manchmal prominente Leute drin, Musiker z. B., die Geld haben und mehr zahlen, also für andere mit.
Für wie viele PatienInnen ist Platz, wer sind die Helfenden?
In der neu eröffneten Einrichtung haben 18 KlientInnen Platz, in 2-4-Bettenzimmern. Auch der alte, bisherige Standort in Kampala ist übrigens mit 18 ausgelastet, zum Teil aber in 8-Bettenzimmern. Es gibt auch ein Einzelzimmer für Menschen, die erst unter Beobachtung entgiften müssen.
Das Team besteht aus Dr. Kalema, er ist Geschäftsführer und hat an der Universität Ghent, Belgien im Bereich Psychologie und Erziehungswissenschaften promoviert, aus einer Oberschwester mit Zusatzqualifikation, Krankenpflegern, einem Arzt, der bei Bedarf hilft, Psychologen, Beratern, Wachmännern und Küchenbeschäftigten. Viele von ihnen kommen nebenberuflich, manche ehrenamtlich stundenweise.
Wie lange sind die KlientInnen da?
Für drei bis sechs Monate, auch je nach Bezahlbarkeit bzw. Leistungsfähigkeit der Familien.
Ist die Therapie so ähnlich wie bei uns im Ablauf?
Im Prinzip ja. Es gibt in Uganda keine spezielle Ausbildung dazu, aber Dr. Kalema hat vieles aus Europa auf afrikanische Verhältnisse adaptiert. Es gibt therapeutische Einzelgespräche, Gruppengespräche, jeder Klient hat einen sogenannten Counselor zur Seite. Bewegung gehört dazu, z. B. auf dem kleinen Fußballplatz, jetzt haben sich Klienten sogar Hanteln selbstgebaut. Und natürlich gibt es Beschäftigungstherapie, es wird gerne gemalt, Karten gebastelt, neulich gab es eine Back-Session. Ein schönes Beispiel ist auch das Hühnerprojekt: Ein Bau, der eigentlich als Wachhäuschen vorgesehen war, ist jetzt Stall für 100 Hühner. Eine Klientin, die völlig depressiv hier ankam, kümmert sich besonders, füttert sie usw. Sie geht darin so sehr auf, dass von Depression keine Rede mehr ist. Und ein anderer Klient ist jetzt glücklicher „Gartenchef“, er baut gerade Tomaten an.
Sie haben wirklich Möglichkeiten jetzt. Da fehlt aber noch einiges.
Wie viele KlientInnen bleiben trocken, wenn sie wieder zu ihren Familien zurückgekehrt sind?
Aus den Berichten von HaB liegt die Quote bei Alkoholikern bei 6 von 10 Klienten und bei Drogenabhängigen bei 4 von 10 bei der Erstbehandlung.
Wie ist das Projekt mit dem ugandischen Partner „Hope and Beyond“ überhaupt entstanden?
Hope and Beyond ist als eine gemeinnützige Gesellschaft auch Mitglied bei MOVENDI International (früher IOGT) so wie FORUT als Entwicklungshilfeorganisation der Guttempler und die Guttempler in Deutschland auch. Wir sind über MOVENDI als Dachverband zusammengekommen, die Zentrale in Stockholm hat uns den Vorschlag unterbreitet. Bevor wir die Arbeit aufgenommen haben, sind wir mit einer kleinen Delegation nach Uganda gereist …
Damals 2018 gab es schon eine ähnliche Einrichtung?
Ein Einfamilienhaus diente als improvisierte Reha-Einrichtung. Aber Dr. Kalema hatte von seinem Doktoranden-Gehalt in Europa immer Geld zurückgelegt und Stück für Stück Land gekauft, weil er immer geplant hatte, das zu vergrößern. Und auch die nächste Generation von Suchtexperten auszubilden, deshalb ist er auch ständig am Schulen. Er macht das aus Überzeugung. Er lebte als Kind bei seiner Tante, die er sehr geliebt hatte, aber sie hatte ein Alkoholproblem. Wenn sie nachts los zog und dann wiederkam, war sie wie ausgewechselt, aggressiv. Sie starb an Leberzirrhose. Er konnte ihr nicht helfen – und hat seine Kindheitsgeschichte in viel positive „Hilfe-Energie“ umgewandelt. Er arbeitet auch mit Angehörigen, Kindern, Partnern und in der Alkoholpolitik.
Woher genau kommt nun das Geld für das Projekt?
Wir bewegen unsere Mitglieder, Förderer und Freunde dazu, Geld zu spenden, manchmal auch Sachspenden. Wir berichten auch immer wieder konkret darüber, welche Bedarfe bestehen und was mit dem Spendengeld passiert – das ist ganz wichtig für SpenderInnen, das konkret zu erfahren. Sie wollen sehen: Aha, diese fünf Betten sind neu, dort die Fenster…!
Was sind die nächsten Pläne?
Die REHAB Einrichtung soll 2030 fertig errichtet sein. Dann sollen wenigsten 60 Klienten zeitgleich dort behandelt werden können. Wir planen aktuell einen richtigen Trakt nur für Frauen, ihr Raum ist bisher nur mit Leichtbauwänden abgetrennt vorne im Behandlungsbereich. Die Erdarbeiten haben bereits begonnen. Dann folgen noch weitere Gebäude. Allerdings Pläne immer wieder an die Realitäten angepasst.
Im Umfeld soll ein Gästehaus entstehen, damit Übernachtungsoptionen für Besucher entstehen, Austausch stattfinden kann. Irgendwann sollen auch Suchttherapeuten aus Europa die Chance erhalten können, dort mal aktiv mitarbeiten zu können …
Für das Gespräch bedankt sich: Anja Wilhelm
*FORUT e.V., die Entwicklungshilfeorganisation der Guttempler in Deutschland, wurde 1987 gegründet. Das Ziel: Unterstützung im Sinne der Grundsätze der Guttempler in Deutschland e.V., Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – Frieden bei der Bekämpfung der Suchtgefahren, beispielsweise durch: Unterstützung von Projekten für Entwicklungsländer, Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungshilfeorganisationen usw. Bisherige Projekte zum Beispiel: Erweiterung der Schule in Kinak, Guinea-Bissau, um die Klassen 5-6, Fertigstellung der Schule in Medina Hafia, Ostercamp für Kinder- und Jugendliche Gambia und Guinea-Bissau, Förderung eines Frauen- und Suchtpräventionsprojektes in Madras/Indien und vieles mehr
hr